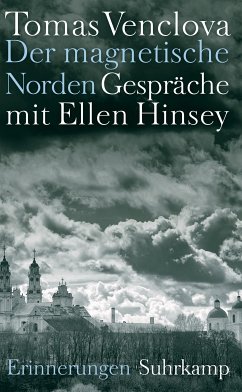In Gesprächen mit seiner Dichterkollegin und Übersetzerin Ellen Hinsey rekapituliert er sein Leben und lässt das 20. Jahrhundert wiederauferstehen: Ob es um Freundschaften geht oder um Fragen der Poesie, ob er über die Politik der Großmächte oder über die verwickelte Geschichte Mittelosteuropas spricht - Venclovas Klugheit und Selbstironie geben dieser großen europäischen Erzählung von Entwurzelung und Heimatlosigkeit etwas heiter Gelassenes.
»Venclova ist ein nördlicher Dichter, geboren und aufgewachsen an der Ostsee, diese Landschaft ist monochrom, Grauschattierungen herrschen vor - das Licht des Himmels, zu Dunkelheit verdichtet. Beim Lesen finden wir uns in dieser Landschaft wieder.« Joseph Brodsky
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH