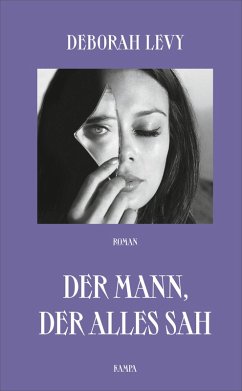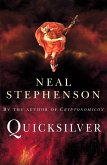London 1988. Der junge Historiker Saul Adler wird auf der Abbey Road angefahren. Nur leicht verletzt steht er auf und posiert für seine Freundin Jennifer Moreau auf dem Zebrastreifen, berühmt geworden durch das Beatles-Album. Das Foto nimmt er mit nach Ostberlin, wo er über den frühen Widerstand gegen den Nationalsozialismus forschen will. Dort begegnet Saul dem Übersetzer Walter Müller und dessen Schwester Luna, deren größter Wunsch es ist, endlich die Penny Lane in Liverpool zu sehen. Mit beiden beginnt Saul eine Affäre - und das Verhängnis nimmt seinen Lauf. Die Geschichte holt Saul ein, seine eigene und die Europas. Zeit und Raum lösen sich auf, Wahrheiten stehen auf schwankendem Grund, und keiner sieht, was der andere sieht. Bis Saul dreißig Jahre später wieder auf der Abbey Road steht - und allmählich begreift, was er, der so vieles zu sehen meinte, nicht erkannt hat, und was die anderen in ihm gesehen haben. Ein Roman darüber, wie wir unsere eigene und die kollektive Geschichte (zurecht)erzählen und wie wenig wir uns selbst über den Weg trauen können, im Leben und in der Liebe.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.