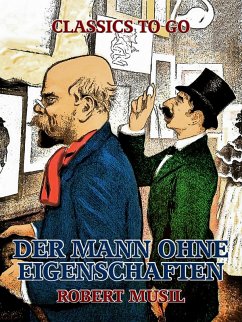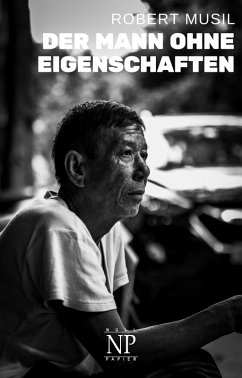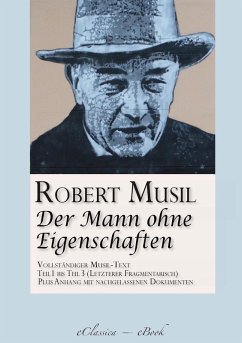Der Mann ohne Eigenschaften (eBook, ePUB)

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Der Mann ohne Eigenschaften ist das Hauptwerk Robert Musils und wird zu den bedeutendsten Romanen des 20. Jahrhunderts gezählt. Es erschien ab 1930 in drei Bänden. Im Mittelpunkt der in der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie angesetzten Handlung steht Ulrich, ein junger Intellektueller auf der Suche nach sinnvoller und ihn ausfüllender beruflicher und privater Existenz, der in vieler Hinsicht Züge von Musil selbst trägt. Von Umständen getrieben und mit ihnen experimentierend, wird Ulrich zum Mitakteur in einer Parallelaktion, in der einflussreiche Kreise der Donaumonarchie das 7...
Der Mann ohne Eigenschaften ist das Hauptwerk Robert Musils und wird zu den bedeutendsten Romanen des 20. Jahrhunderts gezählt. Es erschien ab 1930 in drei Bänden. Im Mittelpunkt der in der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie angesetzten Handlung steht Ulrich, ein junger Intellektueller auf der Suche nach sinnvoller und ihn ausfüllender beruflicher und privater Existenz, der in vieler Hinsicht Züge von Musil selbst trägt. Von Umständen getrieben und mit ihnen experimentierend, wird Ulrich zum Mitakteur in einer Parallelaktion, in der einflussreiche Kreise der Donaumonarchie das 70. Thronjubiläum von Kaiser Franz Joseph im Jahr 1918 vorbereiten. Dieses soll gegenüber dem für dasselbe Jahr zu erwartenden 30. Thronjubiläum des Deutschen Kaisers Wilhelms II. keinesfalls an Glanz und Ausstrahlung zurückstehen.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.