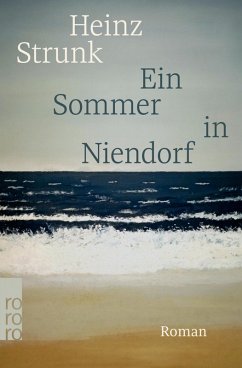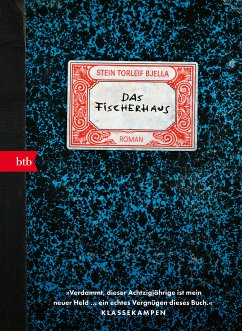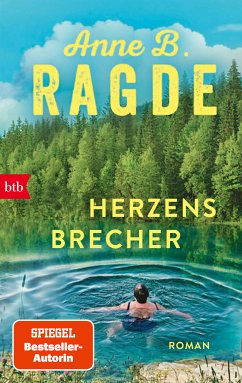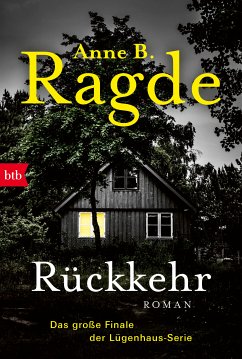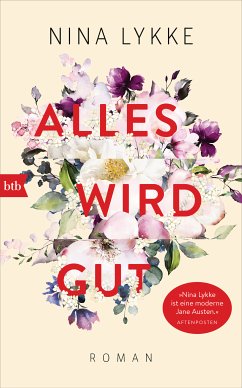Karl Ove Knausgård
eBook, ePUB
Der Morgenstern / Der Morgenstern-Zyklus Bd.1 (eBook, ePUB)
Roman
Übersetzer: Berf, Paul
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 28,00 €**
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!






Es ist Sommer in Norwegen. Eigentlich eine beschauliche, sonnengetränkte Zeit. Doch nun scheint etwas aus den Fugen geraten zu sein. Krabben spazieren an Land, Ratten tauchen an überraschenden Stellen auf, eine Katze kommt unter seltsamen Umständen ums Leben. Kurzum: Die Tiere verhalten sich wider ihre Natur. In seinem neuen Roman schildert Karl Ove Knausgård eine Welt, in der die Natur und die Menschen aus dem Gleichgewicht sind, obwohl das Buch eigentlich ganz realistisch vom Leben einiger Menschen, neun an der Zahl, während mehrerer Hochsommertage erzählt, und zwar in deren eigenen Wo...
Es ist Sommer in Norwegen. Eigentlich eine beschauliche, sonnengetränkte Zeit. Doch nun scheint etwas aus den Fugen geraten zu sein. Krabben spazieren an Land, Ratten tauchen an überraschenden Stellen auf, eine Katze kommt unter seltsamen Umständen ums Leben. Kurzum: Die Tiere verhalten sich wider ihre Natur. In seinem neuen Roman schildert Karl Ove Knausgård eine Welt, in der die Natur und die Menschen aus dem Gleichgewicht sind, obwohl das Buch eigentlich ganz realistisch vom Leben einiger Menschen, neun an der Zahl, während mehrerer Hochsommertage erzählt, und zwar in deren eigenen Worten. Da ist der Literaturprofessor Arne, der mit seiner Familie die Tage im Sommerhaus verbringt, an sich selbst zweifelt und mit seinem Nachbarn Egil über den Glauben an Gott diskutiert. Da ist die Pastorin Kathrine, die plötzlich merkt, dass sie ihre Ehe als Gefängnis empfindet. Da ist der Journalist Jostein, der auf einer exzessiven Trinktour von den mysteriösen Morden an Mitgliedern einer Death Metal Band hört, während seine Frau Turid in einer psychiatrischen Anstalt als Nachtwache arbeitet. Ihnen allen unerklärlich ist das Auftauchen eines neuen Sterns am Himmel, den auch die Wissenschaft nicht wirklich erklären kann. Ist er der Vorbote von etwas Bösem oder im Gegenteil die Verheißung von etwas Gutem?
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
- Geräte: eReader
- ohne Kopierschutz
- eBook Hilfe
- Größe: 1.3MB
- FamilySharing(5)
- Text-to-Speech
- E-Mail des Verlags für Barrierefreiheitsfragen: barrierefreiheit@penguinrandomhouse.de
- Link zur Verlagsseite mit Barrierefreiheitsinformationen: https://www.penguin.de/barrierefreiheit
- Keine Einschränkung der Vorlesefunktionen, außer bei spezifischen Ausnahmen
- Keine oder unzureichende Informationen zur Barrierefreiheit
Karl Ove Knausgård wurde 1968 geboren und gilt als einer der wichtigsten norwegischen Autoren der Gegenwart. Die Romane seines sechsbändigen, autobiographischen Projektes "Min Kamp" wurden weltweit zur Sensation. Sein großer »Morgenstern«-Romankosmos um das plötzliche Auftauchen eines neuen Sterns am Himmel lotet die Abgründe menschlichen Lebens aus und fasziniert mit seiner Soghaftigkeit auf ähnliche Weise. Das Essayistische ist eine treibende Kraft in Knausgårds schriftstellerischem Werk, das in 35 Sprachen übersetzt ist und vielfach preisgekrönt. 2015 erhielt Karl Ove Knausgård den WELT-Literaturpreis, 2017 den Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur, 2022 nahm er in Kopenhagen den Hans-Christan-Andersen-Literaturpreis entgegen. Er lebt in London.

© André Løyning
Produktdetails
- Verlag: Penguin Random House
- Seitenzahl: 896
- Erscheinungstermin: 11. April 2022
- Deutsch
- ISBN-13: 9783641187484
- Artikelnr.: 62909929
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Rezensent Aldo Keel stellt sich mit Karl Ove Knausgard die Frage nach dem Tod und seiner Wirklichkeit. Für Keel gelingt dem Autor mit diesem Buch der Ausbruch aus dem Kerker der Autofiktion. Stark findet Keel die Konzentration des massigen Textes auf zwei Sommertage in Bergen und das Erscheinen eines Himmelsphänomens, das die Menschen aus der Fassung bringt. Krebse fliegen und Tote erwachen zum Leben und Keel fühlt sich wie bei Stephen King. Oder wie bei einem spirituell gewordenen Knausgard.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Ich finde es auf spektakuläre Weise gelungen.« Thea Dorn / ZDF - Das Literarische Quartett
Gebundenes Buch
Ausufernde persönliche Nabelschauen sind so überhaupt nicht mein Fall, weshalb ich um das autobiografische Werk des Norwegers Karl Ove Knausgård bisher einen großen Bogen gemacht habe. Aber nun hat er mit „Der Morgenstern“, wiederum Auftakt eines mehrbändigen …
Mehr
Ausufernde persönliche Nabelschauen sind so überhaupt nicht mein Fall, weshalb ich um das autobiografische Werk des Norwegers Karl Ove Knausgård bisher einen großen Bogen gemacht habe. Aber nun hat er mit „Der Morgenstern“, wiederum Auftakt eines mehrbändigen Zyklus‘, einen fiktionalen Roman abgeliefert, der allein schon durch die Ausgangssituation absolut passend für unsere Gegenwart scheint, die von Ungewissheit und Zweifeln geprägt ist.
Mit dieser Ungewissheit müssen sich auch seine Protagonisten an diesen Tagen im August auseinandersetzen, als am Himmel eine noch nie gesehene Erscheinung auftaucht, für die es keine Erklärung gibt. Nur ein Stern oder die Ankündigung einer Katastrophe? Es herrscht Uneinigkeit bei den neun Menschen, aus deren Sicht wir dieses Ereignis betrachten. Die eine Fraktion erklärt es naturwissenschaftlich rational, die andere tendiert zu einer spirituellen Erklärung, sieht darin ein Omen, das auf das Ende der Welt hinweist und begreift es als Aufforderung, das eigene Dasein zu hinterfragen. Dass Seltsames geschieht, sieht man zuerst am unnatürlichen Verhalten der Tiere. Krebse verlassen ihr natürliches Habitat und spazieren durch den Wald, Elche nähern sich den Menschen, Marienkäfer verdunkeln den Himmel, der Gesang der schwarzen Vögel klingt anders als sonst. Über allem hängt eine graue Endzeitstimmung.
Zwei Tage, neun Perspektiven, minutiös geschildert. Vier Frauen, fünf Männer, die allesamt in schwierigen Lebensumständen feststecken und ihre Situation reflektieren, Fragen nach dem Sinn des Lebens stellen, über die Allgegenwart des Todes sinnieren. Aber er beschreibt nicht nur deren Gedankengänge minutiös, sondern auch deren Alltagsleben mir etwas zu Detail verliebt im Angesicht der (eventuell) drohenden Katastrophe. Über die Bedeutung des Morgensterns lässt er sowohl die Protagonisten als auch die Leser im Unklaren. Es gibt keine Gewissheiten mehr, alles ist in der Schwebe, aber dennoch ist Weitermachen angesagt. Auch in Zeiten, in denen Klimaveränderung, Pandemie oder Krieg gravierende Auswirkungen auf den Alltag haben.
Weniger
Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Alle müssen alles aushalten
Zu Beginn gleich ein Zitat von relativ weit hinten, auf Seite 821: „Was jenseits der Reichweite ihrer Sinne liegt [gemeint sind hier die Tiere], gibt es für sie nicht, es existiert schlichtweg nicht in der Welt.“
Wenn ich mir jetzt die Fische und …
Mehr
Alle müssen alles aushalten
Zu Beginn gleich ein Zitat von relativ weit hinten, auf Seite 821: „Was jenseits der Reichweite ihrer Sinne liegt [gemeint sind hier die Tiere], gibt es für sie nicht, es existiert schlichtweg nicht in der Welt.“
Wenn ich mir jetzt die Fische und andere Wasserlebewesen vorstelle, die natürlich die ganze Welt jenseits des Wassers nicht – oder kaum – wahrnehmen können, so wie die meisten von uns die wirkliche Wasserwelt nicht wahrnehmen können …. Ja, dann bleibt so viel Unerkanntes übrig, wie die ganze Luftwelt für die Fische. Was mag es noch jenseits unserer Wahrnehmungswelt alles geben? Wir wissen ja nicht mal, wer wir wirklich sind und wo wir herkommen. Damit meine ich jetzt nicht die Bäuche unserer Mütter, sondern wo der Mensch an sich herkommt. War er schon immer auf diesem Planeten?
Also zäume ich hier das Pferd vom Schwanz auf und beginne mit dem Ende, bzw. mit dem Anfang vom Essay am Ende.
Knausgård macht es uns hier nicht leicht mit diesem dicken Buch mit seinen 891 Seiten. Es liest sich schön und schrecklich zugleich, aber man bleibt dran, kann es nicht weglegen, obwohl nicht alles gefällt. Bei Weitem nicht alles.
Zunächst fand ich die Anzahl der Protagonisten zu unüberschaubar, fing doch jedes Kapitel mit einem neuen Erzähler an – neun sind es insgesamt – und alle sprachen in der Ich-Form. Wer davon ist so richtig hängen geblieben? Natürlich Arne, das ist der vom Anfang, mit der verrückten Frau, drei Kindern und zwei toten Katzen. Gruselig schon zu Beginn. Er begräbt eine Katze, die noch nicht richtig tot ist und die Katzenmutter dieses armen Tieres stirbt auch keines natürlichen Todes. Hier beginnt schon die Schrägheit der gesamten Atmosphäre im Roman. Arne fährt betrunken Auto und überall auf der Straße laufen Krebse herum. Massenhaft geangelte Fische stinken in Arnes Keller vor sich hin. Auch nach der Abreise aus dem Sommerhaus noch. Die verrückte Ehefrau wird vorher noch schnell ins nächstgelegene Krankenhaus abgeschoben.
Hat der Morgenstern, der neue, das alles ausgelöst und zu verantworten? Die ganze Welt ist aus den Fugen geraten, so wie unsere gerade auch. Da wird alles geleugnet, was nicht ins System passt, und: „Keiner hat jemals ein vernünftiges Gespräch mit einem Leugner geführt. Das geht einfach nicht.“ (Seite 790)
Arne hat einen Nachbarn in diesen Norweger-Sommerhäusern in Bergen am Meer: Egil. Auch Egils Welt ist aus den Fugen geraten, deshalb schrieb er den Essay am Ende: „Über den Tod und die Toten“, ab Seite 817. Hier wird nach viel Philosophie eine Zugbekanntschaft von Egil thematisiert und eine Beerdigung, derlei Merkwürdigkeiten kann man sich kaum ausdenken, die müssen schon so passiert sein.
Der Journalist Jostein ist noch so ein Protagonist, der hängen bleibt im Gedächtnis, einfach weil er solche Unmengen an Alkohol trinken kann, dass man es kaum zu glauben vermag. Er betrügt seine Frau, fällt öfter mal in Ohnmacht, einmal auch ins Koma und irrt seitenlang in der Anderswelt herum.
Die Frauen sind nicht so markant und gerieten ob der Textfülle bei mir mehr oder weniger schon in Vergessenheit: Turid, Josteins Frau, arbeitet in der Psychiatrie. Sie muss mit einem harten Schicksalsschlag fertig werden und Monster im Wald verkraften.
Dann ist da noch Kathrine, die Pfarrerin, mit den Wahnvorstellungen (oder sind es keine?), Vibeke, Solveig und andere.
Manche der Protagonisten kennen sich und begegnen sich, andere wirken wie zufällig ins Buch geraten. Allen gemeinsam ist das Staunen über oder die Angst vor diesem Morgenstern.
Ich weiß nicht, ob das Buch empfehlenswert ist oder nicht. Ich habe es gar nicht gern gelesen und konnte es trotzdem nicht aus der Hand legen. Warum liest man so ein dickes Buch?
Und es werden noch mehr, so die „Androhung“, siehe hier aus dem Interview mit dem Autor: Früher hätte er, deutet er an, wohl zuerst an sein Werk gedacht. Aber das sei nun im Vergleich mit seiner Familie unbedeutend. Trotzdem hat er weiter gro
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
In seinem neuen Roman erzählt K. O. Knausgard aus der Sicht von 9 verschiedenen Menschen, deren Beziehungen zu anderen grundsätzlich problematisch sind. Er berichtet wie gewohnt detailliert und lebensecht aus dem Alltagsleben der Protagonisten. Düster ist die Stimmung, denn es …
Mehr
In seinem neuen Roman erzählt K. O. Knausgard aus der Sicht von 9 verschiedenen Menschen, deren Beziehungen zu anderen grundsätzlich problematisch sind. Er berichtet wie gewohnt detailliert und lebensecht aus dem Alltagsleben der Protagonisten. Düster ist die Stimmung, denn es geschehen merkwürdige Dinge, Vögel kreischen anders als sonst, Massen von Tieren versammeln sich. Die Welt ist aus den Fugen geraten, doch die Menschen machen einfach immer so weiter wie bisher.
Knausgard veranschaulicht damit, wie wir mit Krisen umgehen: wir sehen die Anzeichen von Veränderung z.B. hinsichtlich des Klimas, aber trotzdem läuft alles wie gewohnt weiter.
Knausgard erzeugt in seinem Roman eine schwelende Atmosphäre des Unheils und der Ungewissheit. Es erscheint ein neuer Stern am Himmel, Morgenstern wird er genannt, was hat er zu bedeuten? Quälend ist die Ungewissheit. Die Apocalypse bleibt jedoch aus. Vorerst.
Knausgard erzählt zwar immer noch vom Alltäglichen, aber diesmal spannt er den Bogen zu den wirklich wichtigen, existentiellen Fragen wie etwa die nach der Existenz Gottes. Mit diesem großartigen Werk ist ihm wirklich etwas Neues gelungen. Er erzählt realistisch und plastisch trotz der eingebauten fiktiven Elemente. Die melancholische Grundstimmung ist echt und nachvollziehbar. Der Sprung weg vom Alltäglichen hin zu den existentiellen Fragen ist ihm perfekt gelungen.
Auf die weiteren Romane aus der Reihe darf man gespannt sein.
Weniger
Antworten 2 von 3 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 2 von 3 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Die Länge des Romans hat mich kaum überrascht, ist Karl Ove Knausgård doch vor allem durch sein umfangreiches autobiografisches Projekt bekannt geworden. Diesmal steht jedoch nicht er selbst oder seine Familie im Mittelpunkt, sondern neun fiktive Ich-Erzähler, die in der …
Mehr
Die Länge des Romans hat mich kaum überrascht, ist Karl Ove Knausgård doch vor allem durch sein umfangreiches autobiografisches Projekt bekannt geworden. Diesmal steht jedoch nicht er selbst oder seine Familie im Mittelpunkt, sondern neun fiktive Ich-Erzähler, die in der norwegischen Küstenstadt Bergen leben.
Diese könnten unterschiedlicher nicht sein: eine Pastorin, ein Journalist, eine Krankenschwester … Mühelos wechselt der Autor zwischen den Figuren, gibt jedem einzelnen so klare Konturen und eine eigene Stimme, dass ihre Geschichten einen eigenen Roman füllen würden. Doch Knausgård hat sie alle in ein Buch gepackt, und man fragt sich warum. Eine Gemeinsamkeit haben sie immerhin: Sie beobachten unheimliche Naturphänomene und erleben unerklärliche Dinge, die mir so manches Mal einen Schauer über den Rücken jagten. Einiges erinnerte mich an seine Essaysammlung "Im Winter", in der es auch um das Unbegreifliche des Daseins ging.
Zum Ende hin verdichten sich die Gedanken über die großen existenziellen Themen wie Freiheit, Religion und ein Leben nach dem Tod, die mir viel Konzentration abverlangten. Die Mühe hat sich jedoch gelohnt, auch wenn die einzelnen Geschichten viele Fragen offen ließen. Der Autor beschreibt in dieser Dystopie sehr eindringlich, auf was für eine Welt wir zusteuern, wenn wir aktuelle Krisen ignorieren und immer weitermachen wie bisher.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Knausgards Roman "Der Morgenstern" entwickelt einen unglaublichen Sog. Gerade weil der Autor einen so hyperrealistischen Stil pflegt, ist das Auftauchen parapsychologischer Phänomene so beunruhigend. Ist das der Beginn der Apokalypse oder sind das nur Phantasien überspannter …
Mehr
Knausgards Roman "Der Morgenstern" entwickelt einen unglaublichen Sog. Gerade weil der Autor einen so hyperrealistischen Stil pflegt, ist das Auftauchen parapsychologischer Phänomene so beunruhigend. Ist das der Beginn der Apokalypse oder sind das nur Phantasien überspannter Gehirne? Jedenfalls ist die Auseinandersetzung mit Fragen des Glaubens und des Lebens nach dem Tod selten so lesenswert dargestellt worden.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für
Entdecke weitere interessante Produkte
Stöbere durch unsere vielfältigen Angebote