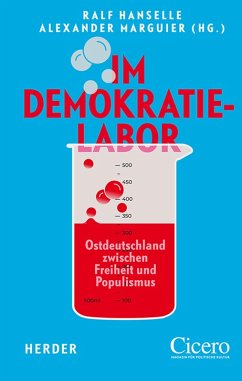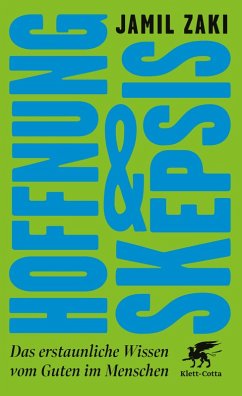Dirk Oschmann
eBook, ePUB
Der Osten: eine westdeutsche Erfindung (eBook, ePUB)
Wie die Konstruktion des Ostens unsere Gesellschaft spaltet
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 12,99 €**
**Preis der gedruckten Ausgabe (Broschiertes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!






»Der Osten hat keine Zukunft, solange er nur als Herkunft begriffen wird.« Was bedeutet es, eine Ost-Identität auferlegt zu bekommen? Eine Identität, die für die wachsende gesellschaftliche Spaltung verantwortlich gemacht wird? Der Attribute wie Populismus, mangelndes Demokratieverständnis, Rassismus, Verschwörungsmythen und Armut zugeschrieben werden? Dirk Oschmann zeigt in seinem augenöffnenden Buch, dass der Westen sich über dreißig Jahre nach dem Mauerfall noch immer als Norm definiert und den Osten als Abweichung. Unsere Medien, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft werden von we...
»Der Osten hat keine Zukunft, solange er nur als Herkunft begriffen wird.« Was bedeutet es, eine Ost-Identität auferlegt zu bekommen? Eine Identität, die für die wachsende gesellschaftliche Spaltung verantwortlich gemacht wird? Der Attribute wie Populismus, mangelndes Demokratieverständnis, Rassismus, Verschwörungsmythen und Armut zugeschrieben werden? Dirk Oschmann zeigt in seinem augenöffnenden Buch, dass der Westen sich über dreißig Jahre nach dem Mauerfall noch immer als Norm definiert und den Osten als Abweichung. Unsere Medien, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft werden von westdeutschen Perspektiven dominiert. Pointiert durchleuchtet Oschmann, wie dieses Othering unserer Gesellschaft schadet, und initiiert damit eine überfällige Debatte. »Wer über den Beitritt und die Folgen sprechen will, wird um dieses Buch nicht herumkommen.« Ingo Schulze
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
- Geräte: eReader
- ohne Kopierschutz
- eBook Hilfe
- Größe: 1.48MB
- FamilySharing(5)
- Text-to-Speech
- Entspricht WCAG Level AA Standards
- Entspricht WCAG 2.2 Standards
- Grundlegende Landmark-Navigation für einfache Orientierung
- ARIA-Rollen für verbesserte strukturelle Navigation
- Hoher Kontrast zwischen Text und Hintergrund (min. 4.5 =>1)
- Inhalte verständlich ohne Farbwahrnehmung
- Sprache des Textes für Text-to-Speech optimiert
- Kurze Alternativtexte für nicht-textuelle Inhalte vorhanden
- Text und Medien in logischer Lesereihenfolge angeordnet
- Navigierbares Inhaltsverzeichnis für direkten Zugriff auf Text und Medien
- Entspricht EPUB Accessibility Specification 1.1
Dirk Oschmann, geboren 1967 in Gotha, ist Professor für Neuere deutsche Literatur an der Universität Leipzig. Sein FAZ-Artikel zum Thema wurde vielfach geteilt und kommentiert.
Produktdetails
- Verlag: Ullstein Taschenbuchvlg.
- Seitenzahl: 224
- Erscheinungstermin: 23. Februar 2023
- Deutsch
- ISBN-13: 9783843729161
- Artikelnr.: 66214617
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Ja, Dirk Oschmann schießt übers Ziel hinaus, das gibt Rezensentin Claudia Schwartz gern zu. Er wird unsachlich und verharmlost die AfD ebenso wie die Putin-Anhängerschaft im Osten. Dennoch hat sein Buch in ihren Augen Gewicht, denn es sei einfach nicht von der Hand zu weisen, mit welcher Abschätzigkeit und Ignoranz der Westen dem Osten begegne. Das hat für Schwartz schon nach der Wende begonnen, als etwa Intellektuelle wie Arnulf Baring und Wolf Jobst Siedler von einem "verzwergten Menschenschlag" und der "Kolonisierungsaufgabe" sprachen, und es setzt sich bis heute fort, wenn etwa Armin Laschet erklärt, die DDR habe die Köpfe der Menschen zerstört, oder wenn sich taz und Spiegel über die mosernden Ossis in ihren Kleingärten und Kantinen mokieren, so die Rezensentin. Die Überheblichkeit, mit der das Buch ihrer Ansicht nach im Westen behandelt wird, spricht für Schwartz ebenfalls Bände.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Dieses Buch wird für Furore sorgen, weil es mit dem alten Muster, den Osten aus dem Westen zu erklären, radikal bricht." Stefan Locke Frankfurter Allgemeine Zeitung 20230307
Gebundenes Buch
Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders...
Jeder, der jetzt denkt, die Ostdeutschen haben ja alle einen Balken im Auge, der sollte unbedingt dieses Buch lesen.
Dazu ein Exkurs: Tauscht man den Balken gegen einen Nagel und schaut sich den besten Kurzfilm aller Zeiten an: „It's not …
Mehr
Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders...
Jeder, der jetzt denkt, die Ostdeutschen haben ja alle einen Balken im Auge, der sollte unbedingt dieses Buch lesen.
Dazu ein Exkurs: Tauscht man den Balken gegen einen Nagel und schaut sich den besten Kurzfilm aller Zeiten an: „It's not about the nail.“ (überall im Netz zu finden) - dann wird das Missverhältnis von Wahrnehmung klar; denn wo „der Westen“ sich den Anschein gibt, beziehungsorientiert („talk to me“) zu sein, möchte er doch von Inhalten („You do have a nail in your head“) nichts wissen und leidet am Nagel in seinem eigenen Kopf. „That sounds really hard.“
Dirk Oschmann ist hier wirklich die Umkehr eines schon lange existierenden pathologischen Vorwurfs gelungen, obwohl diese Metapher aus der Bergpredigt in seinem Buch gar nicht vorkommt.
Der Vorwurf lautet: Der Osten jammert, obwohl der Westen liefert. Schließlich sei ja viel Geld in den Osten geflossen.
Oschmann stellt klar: Der Osten wurde zu großen Teilen von Westdeutschen, die die Treuhand verwalteten, an Westdeutsche verkauft. Eliten an Universitäten und Gerichten wurden durch Westdeutsche neu besetzt. Danach konnten prima die mitgebrachten Netzwerke arbeiten und mögliche neue Andockstellen (mein Wort) schneller besetzen als Ostdeutsche. Das ist bis heute so. Abgesehen davon beträgt der Lohnabstand zwischen Ost und West 22,5 Prozent (2021).
Das sogenannte Jammern der Ostdeutschen ist in den Ohren der Westdeutschen allerdings ein Lärm, ein Störgeräusch, eben ein Fremdkörper (wie ein Nagel im Kopf s.o.) - wird aber als Problembeschreibung nicht erkannt.
Oschmann kommentiert, freilich mit couragiertem Duktus, das westdeutsche Normativ dem sich die Ostdeutschen unterzuordnen haben mit Beispielen aus der Literatur (Kafka, Freytag), schließlich ist er ja Germanist, aus soziologischer Perspektive (Bourdieu, Ranciére, Habermas) und hier zudem als teilnehmender Beobachter, denn er ist ja als Ostdeutscher ein zugleich kulturell konstruierter Ostdeutscher und damit prädestiniert dafür.
Ein ganzes Kapitel widmet Oschmann dem sächsischen Dialekt als Verlierersprache und dass er seine Kinder aus Gründen der Assimilation zum Hochdeutsch mittels Taschengelderpressung zwang. Da ich in den 1980ern in Ostberlin gefühlt in jeder zweiten Administration einen Chef vorfand, der sich seines sächsischen Dialektes überhaupt nicht schämte, weil nämlich dieser Tatsache ebenfalls ein heute fast vergessener teilweiser Elitenaustausch vorangegangen war, habe ich an dieser Stelle nur mäßig Mitleid.
Weiterhin gibt Oschmann der Löschung des Text- und Bildgedächtnisses Raum, insofern Kunst der DDR in der bundesdeutschen Gesamtschau vernachlässigt werde. Dann lenkt er den Blick auf eine Auseinandersetzung zwischen dem Ost-Künstler, Neo Rauch, und dem West-Kritiker, Wolfgang Ullrich. Hier waltet Ullrich in seiner Beurteilung der Kunst eben nicht nur als Kritiker der Bilder, sondern zugleich als Diskursmanager über das, was Rauch verbal so von sich gibt. Kein Wunder, dass Rauch dann wirklich malerisch Fäkalkunst produzierte. Der Reflex von Rauch erinnerte mich an ein Bild, genauer eine Lithographie, die ich in den 1980ern in einer Ostberliner Wohnung gesehen hatte: Ein stämmiger Mann hielt einen anderen kopfüber über einen Farbeimer. Unten war zu lesen: „Wann malen Sie denn mal wieder was Farbiges?“ Damals, im Sozialismus, ging es wohl nur um Ikonographie...
Das Buch ist wirklich lesenswert!
Weniger
Toll haben Sie das geschrieben-im Gegensatz die Buchkritken halten das Sachbuch als unwahr, jammernd, eben typisch ossihaft.Ich weder es jetzt also selbst mal in die Hand nehmen und gucken, ob ich auch jammere. Oder es teilweise gut finde. Oder es toll finde. Oder es außergewöhnlich finde.
Immerhin wird uns/mir ja schwarz-weiß-Denken unterstellt. Das wollte ich mit den Abstufungen verhindern.
Nochmals danke!
Gebundenes Buch Ein tolles, lesenswertes und kluges Buch. Die Einschätzungen basieren auf Fakten, an denen man nicht vorbei kommt. Absolut empfehlenswert!
Antworten 7 von 8 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 7 von 8 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Ich habe gut zugehört und kann dem Autor weitgehend zustimmen. Vieles habe ich nicht gewusst. Sachlich, kompetent und informativ erfahren wir die nackten Unterschiede zwischen alten und neuen Bundesländern.
Meine Kurzfassung: die Ostdeutschen bringen eine wichtige demokratische …
Mehr
Ich habe gut zugehört und kann dem Autor weitgehend zustimmen. Vieles habe ich nicht gewusst. Sachlich, kompetent und informativ erfahren wir die nackten Unterschiede zwischen alten und neuen Bundesländern.
Meine Kurzfassung: die Ostdeutschen bringen eine wichtige demokratische Fähigkeit in die Zukunft Deutschlands ein: sie sind höchst sensibel geworden gegen idealistische Vorgaben. Der Sozialismus hat bei ihnen Erkenntnisse hinterlassen, die nicht durch neue westliche Illusionen zu ändern sind.
Die Montagsdemonstrationen in Dresden waren und sind gegen die Islamisierung gerichtet, die heute nach dem 7. Oktober 23 höchste Brisanz gewinnen. Wie wurde vom Westen aus scharf geschossen gegen Menschen, die noch in der Lage waren zu lesen?
Die Grundlagenwerke des Islam nämlich, deren Unterdrückung von Frauen und Vernichtungswille gegen Ungläubige jedem analytisch denkenden Menschen zu denken geben müssen. Natürlich wurde mit der verbalen Massenvernichtungswaffe par excellence bombardiert, dem N-Wort. Gleiches widerfuhr dem Künstler Neo Rauch etc.
Der in der alten DDR sozialisierte J. Gauck sprach sogar von Dunkeldeutschland, die sogenannten demokratischen Parteien schossen mit den immer gleichen Ausgrenzungswaffen gegen Kritik aus dem Osten.
Sie sind heute stumpf geworden und eine Partei scheint den Sieg davonzutragen, die niemand im Westen will. Demokratische Radikalität schafft entsprechende Antworten. Ein äußerst schlechtes Vorgehen von Parteien, Medien und Meinungsführern aus dem Westen. Ihr Stinkefinger (Gabriel) hat nicht funktioniert, so wie Honecker, Ulbricht und Genossen versagt haben.
Die westlichen Totschlagwaffe sind stumpf und man begreift nach diesem Buch, warum ein gemeinsames Ringen um die Zukunft vor allem einen Ost-Westlichen Ausgleich erfordert, Abrüsten, Zuhören und vorurteilsfrei diskutieren.
Weniger
Antworten 2 von 3 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 2 von 3 finden diese Rezension hilfreich
Broschiertes Buch
Danke für dieses Buch! Möge es viele Leser(innen) in ganz Deutschland finden. Auch ich habe wunderbare Menschen westdeutscher Herkunft kennengelernt, aber was Dirk Oschmann hier überaus klug und gut lesbar beschreibt und mit Fakten in Form von Zitaten, Sudienergebnissen u.a. belegt, …
Mehr
Danke für dieses Buch! Möge es viele Leser(innen) in ganz Deutschland finden. Auch ich habe wunderbare Menschen westdeutscher Herkunft kennengelernt, aber was Dirk Oschmann hier überaus klug und gut lesbar beschreibt und mit Fakten in Form von Zitaten, Sudienergebnissen u.a. belegt, entspricht leider auch meinen eigenen Erfahrungen. Darüber hinaus noch war ich erschüttert über das - auch 30 Jahre nach der "Wende" - unverminderte Ausmaß der Benachteiligung, Verächtlichmachung und Ausgrenzung des Ostdeutschen.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch Längst überfällig dieses Buch! Oschmann schreibt, was ich seit Jahrzehnten subtil fühle UND erlebe. Bin Jahrgang 1968. Dank an den Autor und ausdrücklich dem Verlag!
Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch Es hat mich gefesselt , das Buch ! Mir aus dem Herzen gesprochen!
Genauso habe ich die letzten 30 Jahre erlebt und empfunden ! Endlich spricht mal einer Tacheles !
Aber , liebe Ostdeutsche , lasst euch nicht "unterbuttern" , wir wissen , wer wir sind !
Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für