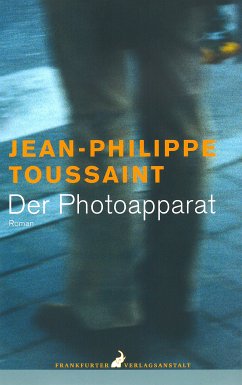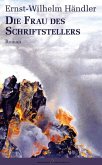Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Neu übersetzt: Jean-Philippe Toussaints "Photoapparat"
Mit seinem Erstlingsroman "Das Badezimmer" hatte Jean-Philippe Toussaint vor zwanzig Jahren schlagartig auf sich aufmerksam gemacht und steht seither für eine minimalistische Erzählform in der gesichtslosen Ich-Form. Mit literarischen Anspielungen, lapidaren Situationen und scheinbar beiläufigen Details bewegt diese sich auf den Rändern zwischen Komik und Absurdität. Die geschilderte Wirklichkeit strotzt von schräger Normalität, daß einem unheimlich wird. "Der Photoapparat", Toussaints dritter Roman aus dem Jahr 1989, geht darin besonders weit. Da tritt ein Mann ins Lokal einer Autofahrschule und interessiert sich zunächst vor allem für das Glockenspiel über der Eingangstür. Er und die junge Angestellte der Fahrschule schalten, bald drinnen, bald draußen stehend, die Türglockenmechanik ein und aus. Dann klingelt das Telefon. Während die Frau den Anruf beantwortet, schiebt der Mann wartend mit den Fingerspitzen Gegenstände über den Schreibtisch.
Alle Romanhandlung scheint statt aus dem Innenleben der Figuren aus einer komplexen Gegenstandstopographie um sie herum zu entspringen. Manchmal auch direkt aus ihrem Körper. Auf Geschäftsreise in Mailand streift den im Park sitzenden Mann ein Sonnenstrahl auf der Nase. Er muß niesen. Beim Weitergehen plagt ihn dann eine Schwiele zwischen den Zehen. Der Besuch bei der Fußpflegerin, zu der Il Signore Gambini, sein italienischer Partner, ihn führt, dauert im knappen Buch drei volle Seiten. Selbst das Denken gelingt am besten, wenn man nicht daran denkt, etwa zeitvergessen beim Pinkeln, auf der Klobrille sitzend. Denken, nicht nachdenken, ist eine Lieblingsbeschäftigung des Erzählers und hat etwas von einer Plätscherbewegung - "besser, den Gedanken in Ruhe seinen heiteren Geschäften nachgehen lassen, so tun, als ob man sich gar nicht für ihn interessiere, sich sanft von seinem Dahinplätschern wiegen lassen und ohne viel Aufhebens nach der Erkenntnis des Seienden streben".
Nein, dieser Mann, der täglich in die Fahrschule kommt und zwischen den Verkehrsschildern herumsitzend versichert, bald werde er auch die vier Paßfotos vorbeibringen, hat kein Problem mit der Realität. Er hat nur seine Taktik. Alles Wirkliche, an dem er sich stößt, zermürbt er mit einer unbeirrbaren Hartnäckigkeit wie eine Olive, die man mit der Gabel bearbeitet, bevor man sie aufspießt. Bald sitzt der Mann neben der jungen Fahrschulsekretärin im Auto, um deren Sohn von der Schule abzuholen, oder fährt mit ihr und ihrem Vater zum Gasflaschenkauf in die ferne Vorstadt. Das Voranstapfen im Gänsemarsch unter dem Regen durch den Vorstadtschlamm, weil das Auto abgesoffen ist, scheint ihn innerlich so wenig zu rühren wie später ein Wochenendausflug mit der jungen Frau nach London.
Der Mann erlebt die Dinge in ihrem Rohzustand, mit Aversionen zwar oder mit Genugtuung, jedoch unvoreingenommen, und registriert um so aufmerksamer deren geringfügigste Oberflächenbeschaffenheit, wie die Bildstruktur eines Fotos. Manchmal möchte er von sich selbst ein Porträt knipsen, auf dem nichts zu sehen wäre - was ihm auf der Rückreise von London mit einem gefundenen Fotoapparat beinah gelungen wäre, doch sind die Bilder seiner verwackelten Füße auf Schiffstreppen nicht entwickelbar. So läuft die Handlung in Situationen von schriller Absonderlichkeit - wenn etwa Fulmar, der korpulente Fahrlehrer, der dem Mann vor zehn Jahren schon einmal das Fahren beibringen sollte, mit dem an einem Faden hinten noch am neuen Pullover baumelnden Etikett durch alle Szenen läuft. Toussaint versteht es, in knappen Zügen uns unlösbare Rätsel in den Alltag zu mischen. Seine Welt liege irgendwo zwischen Jacques Tati und Beckett, wird mitunter gesagt. Mag sein. Doch führen bei ihm die - trotz Dauerregens spärlich vorhandenen - Regenschirme ihr Eigenleben und sitzt Herr Godot von Anfang an mit in der Badewanne.
Joachim Unseld, Jean-Philippe Toussaints deutscher Verleger und kongenialer Übersetzer, hat aber auch noch eine andere Idee über mögliche Einflüsse. Vor einem Jahr ist schon seine Neuübersetzung von "Das Badezimmer" erschienen, jenes mathematisch durchnumerierten Erstlingsromans, in dem ein Mann beschließt, sein Leben fortan in der Wanne zu verbringen, und nur im Mittelteil auf einen Kurzaufenthalt in Venedig ausweicht. Dieser Roman sei eine verdichtete, zeitgenössische, radikalere Fassung von Robert Musils "Mann ohne Eigenschaften", schrieb Unseld unlängst in einem Essay: Wo Musil zugunsten des Gedankens auf die Handlung verzichte, habe Toussaint auch das Darstellungsmittel der direkten oder indirekten Rede aufgegeben.
Der Vergleich scheint etwas hoch gegriffen. Dennoch zeigt Unseld sich als grandioser Kenner seines Autors in allen Nuancen. Dessen mathematisch trockene Ausdrucksknappheit mit den schillernden Satzrändern beherrscht er so souverän wie den banalitätsknisternden Alltagston der Extravaganz. Manchmal leistet er sich sogar das Wagnis einer akzentuierten Wortwahl. Der Mann aus dem "Badezimmer" wird in seinem venezianischen Hotelzimmer plötzlich von einem stechenden Schmerz in der Stirn gequält. Im selben Hotelzimmer hatte er kurz zuvor beim gelangweilten Pfeilwerfen auf die Zielscheibe plötzlich grundlos der ihm von Paris nachgereisten Freundin einen Pfeil in die Stirn gerammt. "Das Leiden war die letzte Gewißheit, daß ich am Leben war, die einzige", tröstet er sich dann. Das "Leiden" (souffrance) oder der "Schmerz" (douleur)? Auf den Unterschied kommt es so sehr an wie auf den zwischen "console" und "comfort", über dem der Venedig-Fahrer bei der Pascal-Lektüre auf englisch brütet. Und daß diese Literatur auf so listvolle Weise untröstlich sein kann, ist die Stärke des Autors Jean-Philippe Toussaint.
JOSEPH HANIMANN
Jean-Philippe Toussaint: "Der Photoapparat". Roman. Aus dem Französischen übersetzt von Joachim Unseld. Frankfurter Verlagsanstalt, Frankfurt 2005. 120 S., geb., 15,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH