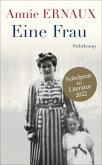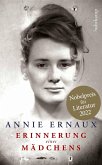Ihr Vater stirbt, und Annie Ernaux nimmt das zum Anlass, sein Leben zu erzählen: Um die Jahrhundertwende geboren, musste er früh von der Schule abgehen, war zunächst Bauer, dann, bis zum Todesjahr 1967, Besitzer eines kleinen Lebensmittelladens in der Normandie, die körperliche Arbeit ließ ihn hart werden gegen seine Familie. Das Leben des Vaters ist auch die Geschichte vom gesellschaftlichen Aufstieg der Eltern und der gleichzeitigen Angst, wieder in die Unterschicht abzurutschen, von der Gefahr, nicht zu bestehen. Dass seine Tochter eine höhere Schule besucht, macht ihn stolz, trotzdem entfernen sich beide voneinander.
Diese Biographie des Vaters ist auch die Geschichte eines Verrats der Tochter: An ihren Eltern, einfachen Menschen, und dem Milieu, in dem sie aufgewachsen ist - gespalten zwischen Zuneigung und Scham, zwischen Zugehörigkeit und Entfremdung.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.

Diese Woche erscheint das Schlüsselbuch im Werk der Schriftstellerin Annie Ernaux: "Der Platz"
Man muss sich das einmal vorstellen: Zwei Monate, nachdem man, 26 Jahre alt, die praktische Prüfung für den höheren Schuldienst bestanden hat, Beamtin geworden ist, es "geschafft" hat, stirbt der eigene Vater. Nach der Beerdigung, beim Zusammensuchen der Kleidung, die man an Bedürftige weitergeben will, findet man in der Alltagsjacke des Toten dessen Portemonnaie und darin einen zusammengefalteten Zeitungsartikel mit den Ergebnissen der Aufnahmeprüfung an der Fachschule für Grundschullehrerinnen, nach Noten sortiert: der eigene Name steht an zweiter Stelle.
So erging es Annie Ernaux, 1966, als ihr Vater starb. Sie war auf Besuch bei den Eltern - mit dem zweieinhalbjährigen Sohn, aber ohne ihren Ehemann, der sich dort "fehl am Platz" vorgekommen wäre -, als der Vater erst krank wurde, dann nicht mehr aufstand. Auf der Rückfahrt nach Hause, im Erste-Klasse-Abteil des Zuges, gehen Ernaux zwei Sätze durch den Kopf: "jetzt gehöre ich wirklich zum Bürgertum" und "es ist zu spät". Mit Hilfe der aus allerärmsten Verhältnissen stammenden Eltern, die den langen Bildungsweg der einzigen Tochter unterstützt haben, ist Ernaux ihrer Klasse entronnen, als Erste in der Familie hat sie studiert. Sie hat ins Bürgertum eingeheiratet, eine Familie gegründet, ihr Sohn ist vom Stigma der bäuerlich-proletarischen Herkunft, der ihr noch anhaftet, endgültig befreit. Der Preis, den sie für den Aufstieg zahlt, ist seit frühester Jugend die Scham über die Eltern, verbunden mit einer zunehmenden Entfremdung, die sie mitunter als Verrat empfindet. Diese drei starken Gefühle aber - Scham, Entfremdung, Verrat - sind die Triebfedern ihres Schreibens. Ohne sie wäre Annie Ernaux nicht Schriftstellerin geworden.
Seit dem Erscheinen von "Die Jahre" und "Erinnerung eines Mädchens" ist Annie Ernaux auch hierzulande Bestsellerautorin. Mit "Der Platz" liegt nun auch das Buch in einer Neuübersetzung von Sonja Finck vor, in dem sie ihre außergewöhnliche Schreibmethode zuerst entwickelt hat. Nach dem Tod des Vaters wollte sie über ihre ambivalenten Gefühle, sein Leben, die "distanzierte Liebe" zu ihm schreiben, darüber, wie schwierig es ist, in eine andere Klasse aufzusteigen, und welchen Preis Aufsteiger wie Zurückgelassene dafür zahlen. Sie beginnt zunächst einen Roman mit dem Vater als Hauptfigur, merkt aber bald, dass sie sein Leben nicht zu Literatur machen kann. Fast zwanzig Jahre dauert es, bis sie Form und Sprache für die "Geschichte" gefunden hat, die sie erzählen will. Als 1983 "La place" bei Gallimard erscheint, erregt die soziologisch anmutende "méthode Ernaux" Aufsehen: Sie hat mit der Fiktion gebrochen, meidet Emotion und Wertung, betont im Individuellen das Exemplarische, verbindet das Persönliche mit dem Historischen. Ihr Stil ist sachlich, nüchtern, kalt. Im Jahr darauf erhält Ernaux den renommierten Prix Renaudot.
"Der Platz" ist das Schlüsselbuch in Ernaux' Werk. Auch wenn sie darin vordergründig das Leben des Vaters rekonstruiert, erzählt, wie er sich "hochgearbeitet" hat - mit zwölf begann er als Knecht bei einem Großbauern, während des Ersten Weltkriegs kam er zum ersten Mal aus seinem Dorf heraus, war in Paris, fuhr mit der Metro, sah, wie andere Leute lebten; dann war er Arbeiter, schließlich Besitzer eines kleinen Lebensmittelladens mit Ausschank -, ist es kein Buch über ihren Vater, sondern über sie selbst. Über ihre Scham, die einsetzte, sobald sie als kleines Mädchen erkannte, dass ihre Art zu leben, sich zu kleiden, sich zu geben, zu reden, mit wenig Ansehen verbunden war. Über ihren Weg des Aufstiegs, voller Demütigungen und Angst, oft allein, weil die Eltern ihr nicht helfen konnten: "Einen ganzen Abend lang fragten wir uns, was die Direktorin wohl mit dem Satz ,für diese Rolle sollte Ihre Tochter Abendgarderobe tragen' gemeint haben könnte."
Anders als die Emanzipation der Eltern, die vor allem eine äußerliche, eine materielle ist, ist die der Tochter eine verborgene, intellektuelle. Die Sprache - oder eigentlich: die Sprachen, denn in der Schule spricht Ernaux nicht mehr Dialekt wie die Eltern, sondern lernt "richtiges Französisch" - ist, je älter sie wird, desto öfter Auslöser von Ärger und Streit. Dass Ernaux schließlich ausgerechnet in dem Medium, das in Frankreich wie kein anderes eines der sozialen Distinktion ist, reüssiert; dass sie nicht nur Gymnasiallehrerin für Französisch, sondern sogar Schriftstellerin wird, ist ein Triumph, den nur ermessen kann, wer einen ähnlich weiten Weg gegangen ist.
Annie Ernaux ist sicher auch deshalb eine so skrupulöse, bild- und metaphernarme, das einzelne Wort betonende Schreibende geworden, weil der Reichtum der Sprache, die Vielfalt der Ausdrucksmöglichkeiten und die Raffinessen von Grammatik und Syntax ihr nicht von kleinauf wie selbstverständlich zur Verfügung standen. "Wenn ich als Kind versuchte, mich besser auszudrücken, hatte ich immer das Gefühl, mich in einen Abgrund zu stürzen", schreibt sie. Bei bestimmten Wörtern schwingt die bedrohliche Bedeutung, die sie für die Eltern hatte, bis heute mit, auch wenn sich diese Bedrohung längst verloren hat. Anders als Proust kann sie das Patois, das normannische Platt, und das Französisch der unteren Schichten nicht pittoresk finden. Proust zähle "entzückt Françoises Fehler und veraltete Ausdrücke auf. Ihn interessiert nur die Ästhetik, weil Françoise sein Hausmädchen war, nicht seine Mutter. Und weil ihm diese Wendungen selbst nie spontan über die Lippen gekommen wären."
Ganz am Ende des Buches berichtet Ernaux von einer Begegnung im Supermarkt im Oktober 1982, kurz bevor sie mit dem Schreiben von "Der Platz" begonnen hat. Sie steht mit dem Einkaufswagen in der Schlange, als sie in der Kassiererin eine ehemalige Schülerin erkennt. Sie spricht sie an, fragt, ob ihr die Arbeit gefalle. Die junge Frau sagt ja, fügt dann aber hinzu: "Das mit der Berufsschule hat nicht geklappt." Ernaux hat alles längst vergessen, fragt auch nicht weiter nach, verabschiedet sich nur noch. "Ich war jetzt Teil jener Hälfte der Welt, für die die andere Hälfte nur Kulisse ist", urteilt sie über sich. Dass das nicht ganz stimmt, beweisen diese Episode wie ihr ganzes Buch "Der Platz". Sie hat nicht vergessen, woher sie kommt, verleugnet weder ihren Vater noch ihre ehemalige Schülerin - die auch sie selbst hätte sein können, wenn sie nicht so hart mit sich gewesen wäre, nicht so ehrgeizig und diszipliniert, und wenn sie, ja, auch das, nicht das Glück gehabt hätte, einen Vater zu haben, dessen "größter Stolz", dessen "Lebenszweck" es war, dass sie "eines Tages der Welt angehöre, die auf ihn herabgeblickt hatte".
BETTINA HARTZ
Annie Ernaux: "Der Platz". Aus dem Französischen von Sonja Finck. Suhrkamp, 95 Seiten, 18 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH