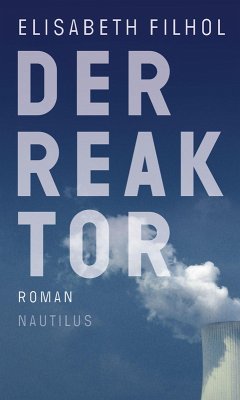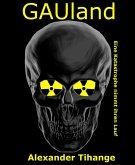Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Das wahre Atommüll-Endlager ist die Literatur - und Kernkraftprosa kommt vor allem aus Frankreich
Dass sich die deutsche Zeitrechnung in "v. F." und "n. F." unterteilt, wobei "F." für Fukushima steht, werden die verbliebenen Kernkraftlobbyisten kaum in ein Argument für die Höchstrisikotechnologie ummünzen können. Die Reaktion lässt sich jedenfalls nicht als typisch deutsche Panik abtun, wenn man sieht, wie sehr auch im Rest der Welt der japanische Unfall, dessen Folgen noch nicht abzusehen sind, den Glauben an die kontrollierte Kernspaltung erschüttert hat. Selbst in traditionell atomverliebten Nationen sind immer weniger Menschen bereit, mit drei Köpfen herumzulaufen, ganze Städte aufzugeben und in Bleisärgen verbuddelt zu werden.
Die schnellsten künstlerischen Antworten auf den Super-GAU am Pazifik wurden denn auch nicht in Deutschland ausgebrütet, sondern aus Frankreich importiert: Zwei kleine Büchlein kommen jetzt bei uns auf den Markt, von denen eines, das literarisch wertvollere, im Original freilich bereits vor der Katastrophe erschienen ist.
Sich mit "Fukushima mon amour" den griffigsten Titel gesichert zu haben, muss man wohl dem in Frankreich lebenden Schweizer Daniel de Roulet zugestehen, wenngleich der Originaltitel, ebenfalls auf den Resnais-Film von 1959 Bezug nehmend, "Tu n'as rien vu à Fukushima" lautet. Der Text ist ein besorgter Brief des Erzählers - des Autors? - an die japanische Freundin Kayoko nur Tage nach dem Unfall, was den Verfasser gleich in die Höflichkeitsbredouille bringt: "Ja, ich wusste, dass Sie mir sagen würden, Ihr Unglück gehe uns nichts an, so als gäbe es dieses Unglück nicht." Dieser Konflikt wird durchaus thematisiert - darin besteht ja auch die Titelanspielung -, aber schließlich beiseitegewischt: "Hätten Sie doch nur recht ..."
Stattdessen gilt, ganz wie in jüngeren Empörungsmanifesten, die Devise: "Offenbar ist es an der Zeit, sich zu entrüsten." Roulet, ein Entrüstungsfachmann, der schon einen Brandanschlag auf Axel Springers Chalet bei Gstaad im Portfolio hat, greift also in die Vollen und parallelisiert einigermaßen erstaunlich "die Monumente des Wahnsinns der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts", nämlich die Konzentrationslager der Nationalsozialisten, mit jenen Tempeln "der Maßlosigkeit der zweiten Hälfte", eben den Atomanlagen: "diese befestigten Lager, manche von ganzen Batterien von Luftabwehrraketen geschützt, wie in La Hague".
Es folgen, gar nicht einmal kunstlos formuliert, zahlreiche bedenkenswerte Überlegungen über "die Arroganz der Technowissenschaft" und die Lächerlichkeit von Argumenten, "nach denen Windräder die Wolken verschmutzen". Mit Blick auf die Internationale Atomenergie-Organisation IAEO heißt es, es sei "an der Zeit, die persönliche Verantwortung dieser Gauner für all das einzufordern, was Sie jetzt durchzustehen haben". Darunter mag sich Roulet vorstellen, dass deren Chalets sich in Rauch auflösen. Nur stellt sich doch die Frage: Was soll die japanische Freundin von diesem Super-GAU des Mitgefühls denken? Vermutlich überhaupt nichts, denn sie wird recht schnell merken, dass gar nicht sie die Angesprochene dieses J'accuse ist, sondern die Welt.
Die aber sollte sich zunächst die Zeit nehmen, den exzellenten, mit dem Prix France Culture Télérama ausgezeichneten Debütroman der französischen Wirtschaftswissenschaftlerin Elisabeth Filhol zu lesen. Auch hier bildet die französische Nuklearindustrie die Kulisse, das allerdings auf eine höchst ungewöhnliche, nämlich vollkommen realistische Weise - und dazu noch im Normalbetrieb.
Die Autorin nimmt die Perspektive Yanns ein, der zum Atom-Prekariat gehört. Tausende junger Männer werden jährlich zwischen März und Oktober bei den Wartungen der Reaktoren und bei ihrer Neubestückung mit Kernbrennstoff eingesetzt, unter Vertrag bei Zeitarbeitsfirmen. Die im Schichtdienst eingesetzten Arbeiter, "Neutronenfutter" genannt, teilen sich Hütten oder Wohnwagen auf extra errichteten Campingplätzen. Die Dauer der Revision, teilt der Erzähler mit, sei in den letzten fünfzehn Jahren halbiert worden. Nur die Älteren erinnern sich noch an eine Zeit, "als Sicherheit noch das oberste Gebot war, nicht nur in den Reden, auch in den Budgets der Auftraggeber".
Wer hier anheuert, eröffnet ein Konto der ganz eigenen Art: "Das ist das Kapital, über das jeder verfügt, zwanzig Millisievert, die maximal erlaubte Strahlendosis über einen Zeitraum von zwölf Monaten. Und wenn noch so viele an vorderster Front umfallen, die Reserve ist scheinbar unerschöpflich."
Umfallen, das heißt: "die Dosis abbekommen", was einen für mindestens eine Saison arbeitsunfähig macht, natürlich ohne jede Entschädigung. Eben das ist der Hauptfigur passiert: Yann hat beim Einsatz im Primärkreislauf einen verstrahlten Gegenstand berührt, ein kleiner Störfall nur, der nun genau rekonstruiert wird. Dabei schweifen seine Gedanken immer wieder ab, hin zu seinem Freund Loïc, der ihn einst zu dieser Tätigkeit überredet hat, inzwischen aber nicht mehr lebt. Es war ein Suizid, kein Strahlenunfall, aber auch dieser Selbstmord ist nur erklärbar vor dem Hintergrund dieser eigentümlich abgeschlossenen Sphäre, in der allenfalls Zwecksolidarität, keine Freundschaft existiert. Eine Bindung zum ungreifbar fernen Energiekonzern besteht nicht, weil man sich am Ende einer langen Kette von Subunternehmen befindet. Darin nämlich besteht die Leistung dieses Romans, so kunstvoll wie lakonisch das Leben dieser Nomaden im weltenthobenen Umfeld der Reaktoren zu beschwören: "Die Zeit ist hier die Zeit des Kraftwerks, das Tag und Nacht läuft. Und die Männer laufen ebenfalls vierundzwanzig Stunden, jeder für acht Stunden, und der Rhythmus muss eingehalten werden, schließlich ist das der ureigenste Rhythmus der Zeit, direkt an der Quelle gemessen, geeicht von Atomuhren."
Warum lassen sich junge Männer darauf ein, den "Körper zu verkaufen, wie Fleisch nach dem Kilopreis"? Eine große Rolle spielt die Faszination für das, "was im Herzen des Kraftwerks vor sich geht". Sie speist sich auch aus dem fast religiös zu nennenden Gefühl, dem Geheimnis nahe zu sein, das die Welt im Inneren zusammenhält. Die auf alles übergehende Strahlung bildet das Sakrament der Atomreligion. Ihr Mysterium ist das Leuchten im Abklingbecken, der Tscherenkow-Effekt, ein "intensives Blau, beinahe übernatürlich, das jedoch weder künstlich erzeugt wird noch Fiktion ist, das Blau des Himmels über der Kasbah, leuchtend, von innen verklärt, ein Blau, das ein Künstler erfunden haben könnte, dessen chemische Formel man zum Patent hätte anmelden können, aber von einer Transparenz und einem Strahlen, für das allein die Natur aus ihrem tiefsten Inneren heraus unseren Blick zu öffnen vermag". Das Blau, das die Romantiker suchten.
Kernkraft, so erfahren wir, das ist - zumindest in Frankreich - nicht nur eine Energie-, sondern eine Lebensform, aber eine, für die es einen faustischen Pakt einzugehen gilt. Einmal tauchen im Kraftwerk Belleville-sur-Loire Umweltaktivisten auf und seilen sich von einem Kühlturm ab. Sie haben recht mit ihrer Warnung, doch wirklich solidarisch kann sich der Erzähler nicht fühlen, obwohl er zugesteht: "Ja, man ist sich der Gefährlichkeit der Atomkraft bewusst. Hinter den Mauern. Ein Schnellkochtopf." Doch man hat sich so weit darauf eingelassen, dass einem für "ein Leben außerhalb der Mauern" die Vorstellungskraft fehlt - was man nach diesen beiden Lektüren wohl durchaus auf das ganze Land hochrechnen darf.
OLIVER JUNGEN Daniel de Roulet: "Fukushima mon amour".
Aus dem Französischen von Maria Hoffmann-Dartevelle. Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 2011. 48 S., br., 4,99 [Euro].
Elisabeth Filhol: "Der Reaktor". Roman.
Aus dem Französischen von Cornelia Wend. Edition Nautilus, Hamburg 2011. 128 S., geb., 16,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH