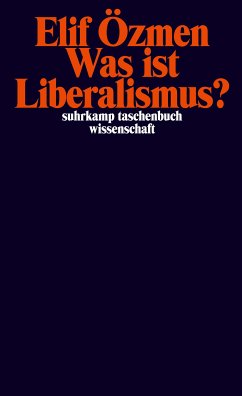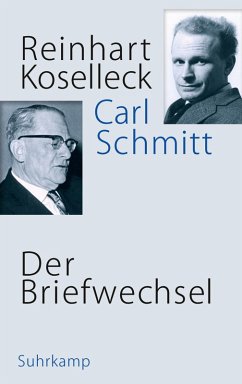Der Streit um Pluralität (eBook, ePUB)
Auseinandersetzungen mit Hannah Arendt
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 28,00 €**
23,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
In zehn hochkonzentrierten Kapiteln legt Juliane Rebentisch Hannah Arendts politische Philosophie der Pluralität frei und diskutiert sie im Horizont gegenwärtiger Debatten. Politik und Wahrheit, Flucht und Staatenlosigkeit, Sklaverei und Rassismus, Kolonialismus und Nationalsozialismus, Moral und Erziehung, Diskriminierung und Identität sowie Kapitalismus und Demokratie sind die Stichworte der entsprechenden Auseinandersetzungen. Indem sie den Fokus auf das Motiv der Pluralität legt, lässt Rebentisch in diesen unterschiedlichen thematischen Kontexten jeweils den Zusammenhang von Arendts G...
In zehn hochkonzentrierten Kapiteln legt Juliane Rebentisch Hannah Arendts politische Philosophie der Pluralität frei und diskutiert sie im Horizont gegenwärtiger Debatten. Politik und Wahrheit, Flucht und Staatenlosigkeit, Sklaverei und Rassismus, Kolonialismus und Nationalsozialismus, Moral und Erziehung, Diskriminierung und Identität sowie Kapitalismus und Demokratie sind die Stichworte der entsprechenden Auseinandersetzungen. Indem sie den Fokus auf das Motiv der Pluralität legt, lässt Rebentisch in diesen unterschiedlichen thematischen Kontexten jeweils den Zusammenhang von Arendts Gesamtwerk ebenso greifbar werden wie die Widersprüche, die es durchziehen.
Das Buch macht vermittels genauer Lektüren und unter Einbeziehung zeitgeschichtlicher Hintergründe die weitreichenden Implikationen von Arendts Denken sichtbar, und zwar vor allem dadurch, dass es die begrifflichen Sperren, die Arendt selbst diesem Denken setzte, klar herausarbeitet und konsequent kritisiert. Gerade deshalb erweist sich der Streit um Pluralität, der hier mit und gegen Hannah Arendt auf beeindruckende Weise ausgetragen wird, als überaus passende Reverenz an eine Autorin, deren Liebe zur Welt sich auch in der Streitbarkeit ihrer Urteile gezeigt hat.
Das Buch macht vermittels genauer Lektüren und unter Einbeziehung zeitgeschichtlicher Hintergründe die weitreichenden Implikationen von Arendts Denken sichtbar, und zwar vor allem dadurch, dass es die begrifflichen Sperren, die Arendt selbst diesem Denken setzte, klar herausarbeitet und konsequent kritisiert. Gerade deshalb erweist sich der Streit um Pluralität, der hier mit und gegen Hannah Arendt auf beeindruckende Weise ausgetragen wird, als überaus passende Reverenz an eine Autorin, deren Liebe zur Welt sich auch in der Streitbarkeit ihrer Urteile gezeigt hat.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.