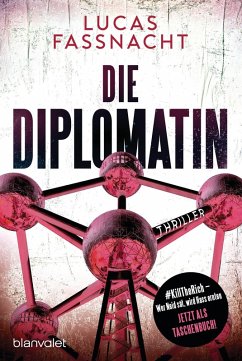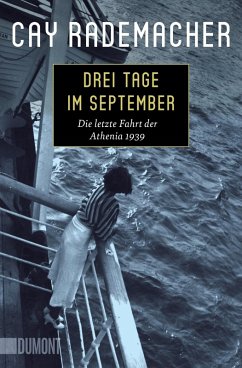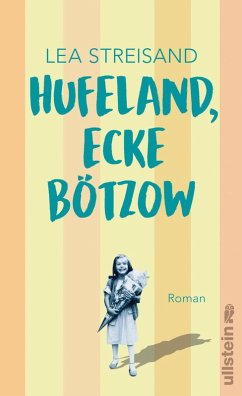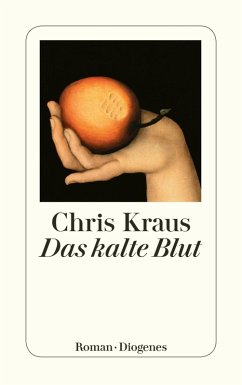Der Taubentunnel (eBook, ePUB)
Geschichten aus meinem Leben Neu als Film - Jetzt zu streamen auf APPLE TV+
Übersetzer: Torberg, Peter

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
»Mitreißend, unterhaltsam und spannend wie einen Thriller erzählt le Carré in Der Taubentunnel sein Leben.« Eckart Baier, Buchjournal Was macht das Leben eines Schriftstellers aus? Mit dem Welterfolg Der Spion, der aus der Kälte kam gab es für John le Carré keinen Weg zurück. Er kündigte seine Stelle im diplomatischen Dienst, reiste zu Recherchezwecken um den halben Erdball - Afrika, Russland, Israel, USA, Deutschland -, traf die Mächtigen aus Politik- und Zeitgeschehen und ihre heimlichen Handlanger. John le Carré ist ein exzellenter und unabhängiger Beobachter, mit untrüglichem...
»Mitreißend, unterhaltsam und spannend wie einen Thriller erzählt le Carré in Der Taubentunnel sein Leben.« Eckart Baier, Buchjournal Was macht das Leben eines Schriftstellers aus? Mit dem Welterfolg Der Spion, der aus der Kälte kam gab es für John le Carré keinen Weg zurück. Er kündigte seine Stelle im diplomatischen Dienst, reiste zu Recherchezwecken um den halben Erdball - Afrika, Russland, Israel, USA, Deutschland -, traf die Mächtigen aus Politik- und Zeitgeschehen und ihre heimlichen Handlanger. John le Carré ist ein exzellenter und unabhängiger Beobachter, mit untrüglichem Gespür für Macht und Verrat. Aber auch für die komischen Seiten des weltpolitischen Spiels. In seinen Memoiren blickt er zurück auf sein Leben und sein Schreiben. Die Memoiren eines Jahrhundertautors Große TV-Doku "Der Taubentunnel" ab 20. Oktober 2023 auf Apple TV+
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.





 buecher-magazin.deDas hat was: John le Carré spricht die Einleitung zu seinen Lebenserinnerungen. Über eine halbe Stunde hört man die Stimme des Mannes, der so ungern Interviews gibt. Auf Deutsch, der Sprache, die er perfekt beherrscht als Ausdruck seines Interesses an deutscher Geschichte und seiner Verbundenheit mit der deutschen Kultur. Man hört sein Alter durch (85), aber auch seine Verschmitztheit. Dann ist man doch froh, dass Walter Kreye energisch und zupackend einen volltönenden Resonanzraum für all die Turbulenzen eines bewegten Lebens schafft. Über seine Geheimdiensttätigkeit schweigt der Meister weiterhin, spielt die Bedeutung herunter, lässt keine Einblicke in sein Innerstes zu. Der Schriftsteller steht im Mittelpunkt, die Romanrecherchen, die ihn zu Treffen mit Arafat und Thatcher sowie in Kriegsgebiete führen. Verachtung und Ablehnung sind spürbar, wenn es um die lange Regentschaft der Nazis in bundesdeutschen Behörden geht oder den Umgang der Politik mit dem vermeintlichen Terroristen Kurnaz. Abschließend beschreibt er seinen Vater, ein Tunichtgut und Hochstapler. Auch hier bewahrt Kreye das, was das Werk auszeichnet: den Ton der Diskretion.
buecher-magazin.deDas hat was: John le Carré spricht die Einleitung zu seinen Lebenserinnerungen. Über eine halbe Stunde hört man die Stimme des Mannes, der so ungern Interviews gibt. Auf Deutsch, der Sprache, die er perfekt beherrscht als Ausdruck seines Interesses an deutscher Geschichte und seiner Verbundenheit mit der deutschen Kultur. Man hört sein Alter durch (85), aber auch seine Verschmitztheit. Dann ist man doch froh, dass Walter Kreye energisch und zupackend einen volltönenden Resonanzraum für all die Turbulenzen eines bewegten Lebens schafft. Über seine Geheimdiensttätigkeit schweigt der Meister weiterhin, spielt die Bedeutung herunter, lässt keine Einblicke in sein Innerstes zu. Der Schriftsteller steht im Mittelpunkt, die Romanrecherchen, die ihn zu Treffen mit Arafat und Thatcher sowie in Kriegsgebiete führen. Verachtung und Ablehnung sind spürbar, wenn es um die lange Regentschaft der Nazis in bundesdeutschen Behörden geht oder den Umgang der Politik mit dem vermeintlichen Terroristen Kurnaz. Abschließend beschreibt er seinen Vater, ein Tunichtgut und Hochstapler. Auch hier bewahrt Kreye das, was das Werk auszeichnet: den Ton der Diskretion.