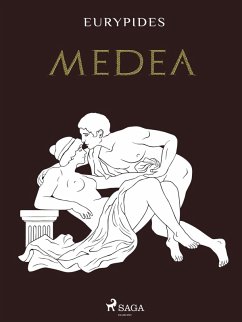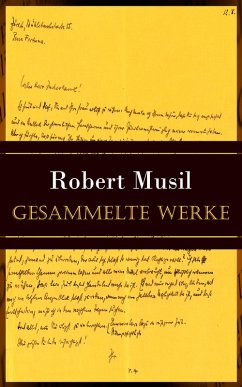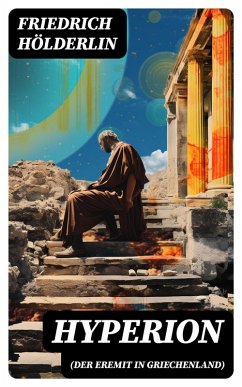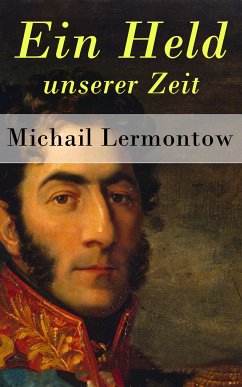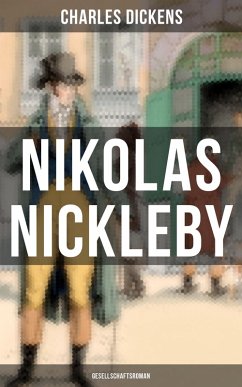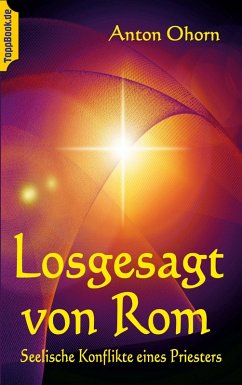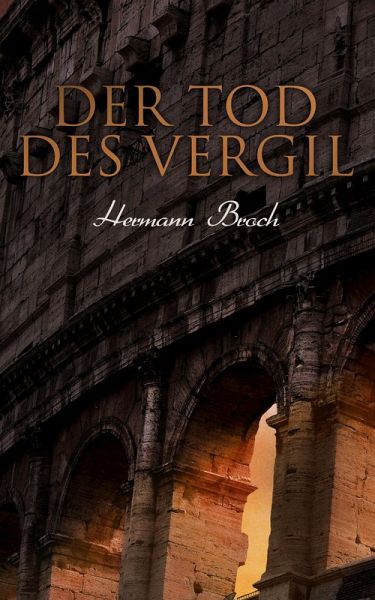
Der Tod des Vergil (eBook, ePUB)
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
1,99 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
"Der Tod des Vergil" ist ein Roman, in deren erzählt der Autor von den letzten Lebensstunden des römischen Dichters Virgil im Hafen von Brundisium nach. Virgils gesteigerte Wahrnehmungen während seines Todes erinnern an sein Leben und an die Zeit, in der er lebt. Der Dichter befindet sich in der Zeit zwischen Leben und Tod, so wie seine Kultur zwischen dem heidnischen und dem christlichen Zeitalter schwankt. Während er darüber nachdenkt, erkennt Virgil, dass die Geschichte an einem Scheitelpunkt steht und dass er in seinem Versuch, Schönheit zu schaffen, die Realität verfälscht haben k...
"Der Tod des Vergil" ist ein Roman, in deren erzählt der Autor von den letzten Lebensstunden des römischen Dichters Virgil im Hafen von Brundisium nach. Virgils gesteigerte Wahrnehmungen während seines Todes erinnern an sein Leben und an die Zeit, in der er lebt. Der Dichter befindet sich in der Zeit zwischen Leben und Tod, so wie seine Kultur zwischen dem heidnischen und dem christlichen Zeitalter schwankt. Während er darüber nachdenkt, erkennt Virgil, dass die Geschichte an einem Scheitelpunkt steht und dass er in seinem Versuch, Schönheit zu schaffen, die Realität verfälscht haben könnte.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.