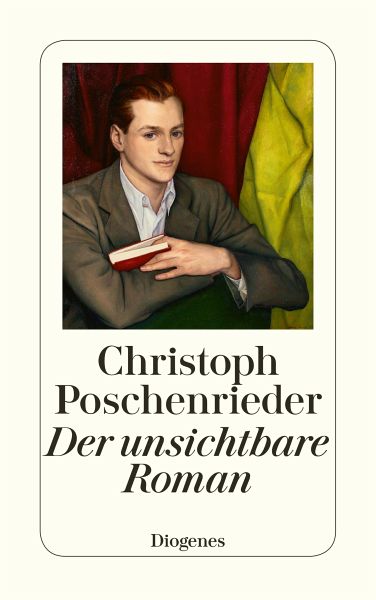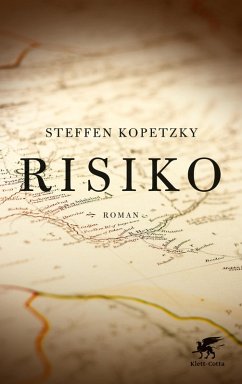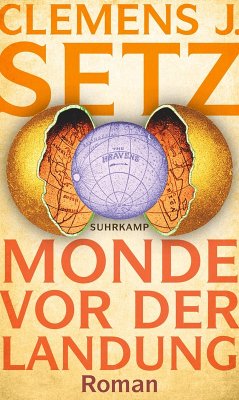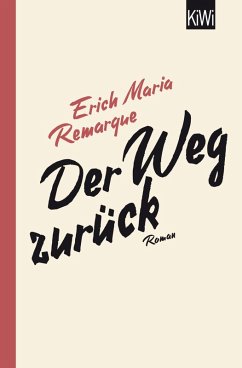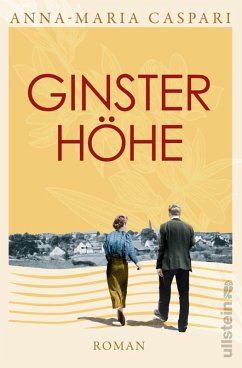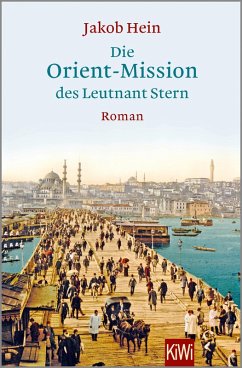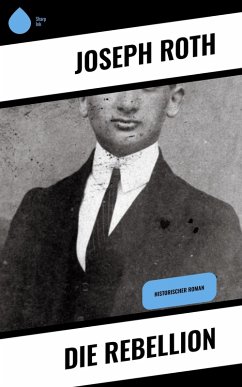Christoph Poschenrieder
eBook, ePUB
Der unsichtbare Roman (eBook, ePUB)
Sofort per Download lieferbar
Statt: 24,00 €**
**Preis der gedruckten Ausgabe (Buch mit Leinen-Einband)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!






Wer ist schuld am Ersten Weltkrieg? Im Jahr 1918 wird die Frage immer drängender. Da erhält der Bestsellerautor Gustav Meyrink in seiner Villa am Starnberger See ein Angebot vom Auswärtigen Amt: Ob er - gegen gutes Honorar - bereit wäre, einen Roman zu schreiben, der den Freimaurern die Verantwortung für das Blutvergießen zuschiebt. Der ganz und gar unpatriotische Schriftsteller und Yogi kassiert den Vorschuss - und bringt sich damit in Teufels Küche.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
- Geräte: eReader
- ohne Kopierschutz
- eBook Hilfe
- Größe: 0.87MB
- FamilySharing(5)
- Text-to-Speech
- Keine oder unzureichende Informationen zur Barrierefreiheit
Christoph Poschenrieder, geboren 1964 bei Boston, studierte Philosophie in München und Journalismus in New York und arbeitet als freier Journalist und Autor von Dokumentarfilmen. Heute konzentriert er sich auf das literarische Schreiben. Sein Debüt >Die Welt ist im Kopf< wurde vom Feuilleton gefeiert und war auch international erfolgreich. Mit >Das Sandkorn< war er 2014 für den Deutschen Buchpreis nominiert. Christoph Poschenrieder lebt in München.
Produktdetails
- Verlag: Diogenes eBooks
- Seitenzahl: 272
- Erscheinungstermin: 25. September 2019
- Deutsch
- ISBN-13: 9783257609899
- Artikelnr.: 56571682
Vom Gustl und Gigerl zum Yogi
Gut sichtbar und lesbar: Christoph Poschenrieders "Unsichtbarer Roman" über Gustav Meyrink
Wie Pat Barker hat auch Christoph Poschenrieder eine Trilogie des Ersten Weltkriegs geschrieben. Aber im Gegensatz zu der englischen Schriftstellerin erzählt er nicht chronologisch-realistisch, sondern eher ironisch augenzwinkernd, mit einem dokumentarischen Gestus, der die Grenzen zwischen Fakten und Fiktion verschwimmen lässt. In seinem etwas überambitionierten Roman "Der Spiegelkasten" ließ Poschenrieder die Phantomschmerzen und echten Neurosen der Kriegszitterer in den Gerätschaften und magischen Effekten der digitalen Moderne aufscheinen. In "Das Sandkorn" fiel ein homosexueller
Gut sichtbar und lesbar: Christoph Poschenrieders "Unsichtbarer Roman" über Gustav Meyrink
Wie Pat Barker hat auch Christoph Poschenrieder eine Trilogie des Ersten Weltkriegs geschrieben. Aber im Gegensatz zu der englischen Schriftstellerin erzählt er nicht chronologisch-realistisch, sondern eher ironisch augenzwinkernd, mit einem dokumentarischen Gestus, der die Grenzen zwischen Fakten und Fiktion verschwimmen lässt. In seinem etwas überambitionierten Roman "Der Spiegelkasten" ließ Poschenrieder die Phantomschmerzen und echten Neurosen der Kriegszitterer in den Gerätschaften und magischen Effekten der digitalen Moderne aufscheinen. In "Das Sandkorn" fiel ein homosexueller
Mehr anzeigen
Kunsthistoriker aus seiner Rolle als Indiana Jones deutschnationaler Geschichtsklitterung und begann in den Straßen Berlins buchstäblich Sand ins Getriebe der Kriegsmaschinerie zu streuen. Im dritten Band seiner Weltkriegstrilogie porträtiert Poschenrieder nun wieder einen Künstler, der die wilhelminische Kriegs- und Lügenindustrie von innen her zersetzt: Gustav Meyrink (1868 bis 1932), Autor des "Golem" und als Mitarbeiter des "Simplicissmus" ein scharfer Kritiker des deutschen Spießertums.
Historisch verbürgt ist, dass Meyrink 1917 im Auftrag der Propagandaabteilung des Auswärtigen Amts einen Roman schreiben sollte, der die damals schon leidige Kriegsschuldfrage ein für alle Mal beantworten würde: Verantwortlich für alles war, natürlich, wieder mal das internationale Freimaurertum. Wie das Außenministerium ausgerechnet auf den "Golem"-Autor verfiel, lässt sich heute nur noch schwer nachvollziehen. Meyrink war berühmt und berüchtigt für seine Exzentrik, seine Freigeisterei und seine Satiren auf Vaterlandsaffen, Pastorenweibsen und "Teutobolde"; die Rechten beschimpften ihn als dekadenten "völkischen Schädling" und mutmaßlichen Juden.
In Berlin war man aber offenbar geneigt, über Meyrinks zweifelhaften Ruf hinwegzusehen: Ein linker Autor konnte die Glaubwürdigkeit rechter Verschwörungstheorien nur fördern, und "wenn es außerdem unterhaltsam wäre, schadet es auch nichts". "Wir machen hier Propaganda", klärt bei Poschenrieder der zuständige Legationsrat auf: "Das ist nicht die feine Dichtkunst. Da muss sich nichts reimen. Es geht nicht um Stil. Es geht um Wirkung." Meyrink selber reagiert anfangs irritiert: Warum gerade er, warum nicht Frenssen oder Ganghofer? Und warum gerade Freimaurer? Warum nicht die Juden als übliche Schuldige, Friseure oder Mohikaner, wie Erich Mühsam spottet?
Andererseits, warum nicht? Meyrink erwies sich in seinem Leben mehrfach als außerordentlich wandlungsfähig. Geboren als Gustav Meyer, Spross einer Affäre zwischen einer Schauspielerin und einem württembergischen Minister, war er Bankier und verurteilter Betrüger, Okkultist und Aufklärer, Gigerl und Ruderer, Yogi, Spiritist und leidenschaftlicher Automobilist. Der Yoga, wie das damals noch hieß, heilt ihn von seinem Rückenleiden und wird zu seiner Religion. Mit dem Schreiben begann er erst spät, mit Mitte dreißig, und nur des Geldes wegen. Andererseits sagt seine Frau im Roman: "Der Gustl ist der Gustl so richtig nur, wenn der Gustl schreibt."
1917 ist der Ruhm des "Golem"-Gustl allerdings schon verblasst. Die Villa am Starnberger See, Segelboot und Automobil wollen bezahlt sein, und so nimmt Meyrink das unsittliche Angebot schließlich an. Sein Führungsoffizier ist übrigens Bernhard von Hahn, nicht Kurt Hahn, der im selben Amt arbeitet. Poschenrieder spielt die Namensgleichheit zwischen Legationsrat und Reformpädagoge bis hinein in Archivrecherchen und Briefwechsel mit seiner Lektorin durch. Aber ob Hahn, Huhn oder Ei: Als Ghostwriter eines zu allem fähigen Literaten läuft auch Poschenrieder (der sogar erst mit Mitte vierzig zu schreiben begann) zu großer Form auf.
Der Freimaurer-Roman wird darum nicht schneller fertig. Meyrink leidet zum ersten Mal an Schreibblockade und moralischer Prokrastination: Ihn ekelt vor der Vorstellung, seinen leidlich guten Ruf für Fake News und Lügenpropaganda zu verkaufen. So überhört er das lauter werdende Drängen aus Berlin und flüchtet sich lieber nach München, wo sich gerade Revolution und Räterepublik zusammenbrauen. Meyrink kennt die Helden der Bierhallen und Kaffeehäuser: Mit Erich Mühsam ist er befreundet, Kurt Eisner genießt seinen kollegialen Respekt. Als sich die Auftraggeber des Freimaurer-Machwerks nicht mehr länger hinhalten lassen, liefert er einen Roman ab, der, ohne Farbbänder rasch auf weißes Papier getippt, buchstäblich unlesbar wird. Was aber bleibt, stiften die Dichter, und was sichtbar oder jedenfalls gut lesbar ist, verdanken wir Poschenrieder. Sein erster, doppeldeutiger Satz "Es klopft" - mitten in eine spiritistische Sitzung in Meyrinks Villa platzt der Bote aus Berlin - ist auch der Anfang und das Ende von Meyrinks Auftragsroman.
Meyrink, der Hobby-Alchemist, Banker und Ungustl, macht aus Dreck Gold und aus Propaganda Literatur, und sein Doppelgänger Poschenrieder macht es ihm nach. "Der unsichtbare Roman" hat, wie jeder andere Roman auch, Anfang, Mitte und Ende, Vor- und Nachwort; er ist ein feines Lebensbild des Schriftstellers Meyrink, aber eigentlich eher eine Sammlung von Porträts, Anekdoten und ironischen Betrachtungen als ein richtiger Roman. Poschenrieder beschreibt das "innere Schauen" im Schreibprozess und reflektiert sich in Meyrink als gehobener Unterhaltungsautor mit politischer Verantwortung; derart hat die launig-luftige postmoderne Scharade immer auch einen ernsten doppelten Boden. Meyrink war 1918 als Schriftsteller erledigt; Spätwerke wie "An der Grenze des Jenseits" oder "Der Engel vom westlichen Fenster" verkauften sich nur noch schleppend. 1928 verkaufte er seine Villa und trat zum Buddhismus über. Seinen Freimaurer-Roman hat übrigens ein gewisser Friedrich Wichtl zu Ende geschrieben: Dieser Dr. Wichtl, Geigenlehrer und deutschnationaler Politiker, veröffentlichte 1919 das vielgelesene Schauermärchen "Weltfreimaurerei - Weltrevolution - Weltrepublik".
MARTIN HALTER
Christoph Poschenrieder: "Der unsichtbare Roman". Roman.
Diogenes Verlag,
Zürich 2019. 272 S.,
geb., 24,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Historisch verbürgt ist, dass Meyrink 1917 im Auftrag der Propagandaabteilung des Auswärtigen Amts einen Roman schreiben sollte, der die damals schon leidige Kriegsschuldfrage ein für alle Mal beantworten würde: Verantwortlich für alles war, natürlich, wieder mal das internationale Freimaurertum. Wie das Außenministerium ausgerechnet auf den "Golem"-Autor verfiel, lässt sich heute nur noch schwer nachvollziehen. Meyrink war berühmt und berüchtigt für seine Exzentrik, seine Freigeisterei und seine Satiren auf Vaterlandsaffen, Pastorenweibsen und "Teutobolde"; die Rechten beschimpften ihn als dekadenten "völkischen Schädling" und mutmaßlichen Juden.
In Berlin war man aber offenbar geneigt, über Meyrinks zweifelhaften Ruf hinwegzusehen: Ein linker Autor konnte die Glaubwürdigkeit rechter Verschwörungstheorien nur fördern, und "wenn es außerdem unterhaltsam wäre, schadet es auch nichts". "Wir machen hier Propaganda", klärt bei Poschenrieder der zuständige Legationsrat auf: "Das ist nicht die feine Dichtkunst. Da muss sich nichts reimen. Es geht nicht um Stil. Es geht um Wirkung." Meyrink selber reagiert anfangs irritiert: Warum gerade er, warum nicht Frenssen oder Ganghofer? Und warum gerade Freimaurer? Warum nicht die Juden als übliche Schuldige, Friseure oder Mohikaner, wie Erich Mühsam spottet?
Andererseits, warum nicht? Meyrink erwies sich in seinem Leben mehrfach als außerordentlich wandlungsfähig. Geboren als Gustav Meyer, Spross einer Affäre zwischen einer Schauspielerin und einem württembergischen Minister, war er Bankier und verurteilter Betrüger, Okkultist und Aufklärer, Gigerl und Ruderer, Yogi, Spiritist und leidenschaftlicher Automobilist. Der Yoga, wie das damals noch hieß, heilt ihn von seinem Rückenleiden und wird zu seiner Religion. Mit dem Schreiben begann er erst spät, mit Mitte dreißig, und nur des Geldes wegen. Andererseits sagt seine Frau im Roman: "Der Gustl ist der Gustl so richtig nur, wenn der Gustl schreibt."
1917 ist der Ruhm des "Golem"-Gustl allerdings schon verblasst. Die Villa am Starnberger See, Segelboot und Automobil wollen bezahlt sein, und so nimmt Meyrink das unsittliche Angebot schließlich an. Sein Führungsoffizier ist übrigens Bernhard von Hahn, nicht Kurt Hahn, der im selben Amt arbeitet. Poschenrieder spielt die Namensgleichheit zwischen Legationsrat und Reformpädagoge bis hinein in Archivrecherchen und Briefwechsel mit seiner Lektorin durch. Aber ob Hahn, Huhn oder Ei: Als Ghostwriter eines zu allem fähigen Literaten läuft auch Poschenrieder (der sogar erst mit Mitte vierzig zu schreiben begann) zu großer Form auf.
Der Freimaurer-Roman wird darum nicht schneller fertig. Meyrink leidet zum ersten Mal an Schreibblockade und moralischer Prokrastination: Ihn ekelt vor der Vorstellung, seinen leidlich guten Ruf für Fake News und Lügenpropaganda zu verkaufen. So überhört er das lauter werdende Drängen aus Berlin und flüchtet sich lieber nach München, wo sich gerade Revolution und Räterepublik zusammenbrauen. Meyrink kennt die Helden der Bierhallen und Kaffeehäuser: Mit Erich Mühsam ist er befreundet, Kurt Eisner genießt seinen kollegialen Respekt. Als sich die Auftraggeber des Freimaurer-Machwerks nicht mehr länger hinhalten lassen, liefert er einen Roman ab, der, ohne Farbbänder rasch auf weißes Papier getippt, buchstäblich unlesbar wird. Was aber bleibt, stiften die Dichter, und was sichtbar oder jedenfalls gut lesbar ist, verdanken wir Poschenrieder. Sein erster, doppeldeutiger Satz "Es klopft" - mitten in eine spiritistische Sitzung in Meyrinks Villa platzt der Bote aus Berlin - ist auch der Anfang und das Ende von Meyrinks Auftragsroman.
Meyrink, der Hobby-Alchemist, Banker und Ungustl, macht aus Dreck Gold und aus Propaganda Literatur, und sein Doppelgänger Poschenrieder macht es ihm nach. "Der unsichtbare Roman" hat, wie jeder andere Roman auch, Anfang, Mitte und Ende, Vor- und Nachwort; er ist ein feines Lebensbild des Schriftstellers Meyrink, aber eigentlich eher eine Sammlung von Porträts, Anekdoten und ironischen Betrachtungen als ein richtiger Roman. Poschenrieder beschreibt das "innere Schauen" im Schreibprozess und reflektiert sich in Meyrink als gehobener Unterhaltungsautor mit politischer Verantwortung; derart hat die launig-luftige postmoderne Scharade immer auch einen ernsten doppelten Boden. Meyrink war 1918 als Schriftsteller erledigt; Spätwerke wie "An der Grenze des Jenseits" oder "Der Engel vom westlichen Fenster" verkauften sich nur noch schleppend. 1928 verkaufte er seine Villa und trat zum Buddhismus über. Seinen Freimaurer-Roman hat übrigens ein gewisser Friedrich Wichtl zu Ende geschrieben: Dieser Dr. Wichtl, Geigenlehrer und deutschnationaler Politiker, veröffentlichte 1919 das vielgelesene Schauermärchen "Weltfreimaurerei - Weltrevolution - Weltrepublik".
MARTIN HALTER
Christoph Poschenrieder: "Der unsichtbare Roman". Roman.
Diogenes Verlag,
Zürich 2019. 272 S.,
geb., 24,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
»Der hat so einen Spaß am Formulieren, dieser Christoph Poschenrieder – einer der besten deutschen Schriftsteller zurzeit.«
„Meyrink fühlt sich erloschen. Der Docht nimmt keine Flamme an. Bis über die Knöchel steht er in abgebrannten Zündhölzern.“ (Zitat Seite 153)
Inhalt
Gustav Meyrink, der bekannte Autor des „Golem“, braucht dringend einen neuen erfolgreichen Roman, …
Mehr
„Meyrink fühlt sich erloschen. Der Docht nimmt keine Flamme an. Bis über die Knöchel steht er in abgebrannten Zündhölzern.“ (Zitat Seite 153)
Inhalt
Gustav Meyrink, der bekannte Autor des „Golem“, braucht dringend einen neuen erfolgreichen Roman, um seinen aufwändigen Lebensstil weiterhin finanzieren zu können. Demnächst wird er fünfzig Jahre alt und es fehlen ihm die Ideen für einen neuen Stoff. Als er 1917 vom Auswärtigen Amt in Berlin angefragt wird, ob er eine Auftragsarbeit schreiben will, stimmt er nach kurzem Überlegen zu. Allerdings muss der neue Roman beweisen, dass die Freimaurer am Ausbruch des Ersten Weltkriegs schuld sind. Hier beginnt das Problem für Meyrink, denn trotz der umfangreichen Unterlagen, die er aus Berlin erhält, hat er keine Idee, wie er dies umsetzen soll und er will dieses Buch auch nicht schreiben.
Thema und Genre
Dieser biografische Roman schildert eine spannende, wenig bekannte Episode im Leben des Schriftstellers Gustav Meyrink. Der Autor verknüpft gekonnt Fakten mit der Geschichte und Handlung, die er in seinem Buch erzählt.
Charaktere
Der Schriftsteller Gustav Meyrink, Mitglied in mehreren okkulten Geheimbünden, ist ein unpolitischer Mensch, obwohl er natürlich informiert ist und ein guter Beobachter. Er braucht das Honorar, das ihm von Berlin angeboten wird und geht eine Verpflichtung ein, als er den Vorschuss gegen sein besseres Wissen annimmt. Er kämpft mit dem eigenen Gewissen und dies führt zu einer Schreibblockade. Der Autor hält sich bei der Schilderung des Hauptprotagonisten an die bekannten biografischen Tatsachen, die er in die Problematik seines Romans einbaut.
Handlung und Schreibstil
Die Handlung erstreckt sich über einen kurzen Zeitraum 1917/1918, und wird durch Rückblenden ergänzt, welche vergangene Ereignisse im Leben Meyrinks schildern, sodass sich für den Leser aus dem Roman auch eine Biografie des Schriftstellers ergibt. Geschrieben in der personalen Erzählperspektive mit Fokus auf den Hauptprotagonisten Meyrink, wechseln die Erinnerungen in die Ich-Form. Ergänzt wird die Handlung durch sachliche Recherchenotizen, welche einzelne Fakten belegen.
Der Roman mischt gekonnt Tatsachen mit Fiktion und als Leser fühlt man sich mitten in den Ereignissen, spürt die Zerrissenheit Meyrinks, aber auch seine humorvoll-kritische Art, das Leben, auch sein eigenes, zu sehen. Genial ist die Lösung, die der Autor als Meyrinks Idee für die Umsetzung dieses problematischen Auftrags anbietet.
Poschenrieders Sprache ist großartig zu lesen, seine Beschreibungen treffen den Punkt, sie malen Bilder und sehen seine Hauptfigur Meyrink mit sachlichem Humor, dessen Zweifel auf Grund des eigenen Verhaltens werden intensiv und nachvollziehbar charakterisiert. Die Schilderung der Schreibblockade zum Beispiel ist Sprachperfektion und Lesegenuss.
Fazit
Ein biografischer Roman, in dessen Mittelpunkt das abwechslungsreiche Leben des Schriftstellers Gustav Meyrink steht und hier vor allem eine politische Auftragsarbeit, die er gegen Ende des Ersten Weltkriegs auf Grund von Geldsorgen angenommen hatte. Eine spannende, sprachlich großartige Mischung aus Fiktion und Fakten.
Weniger
Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Christoph Poschenrieders Bücher zu lesen, macht einfach Spaß, da sie gut geschrieben sind. Man fliegt durch die Seiten und die Geschichte wächst und wächst. Es ist immer ein Augenzwinkern dabei und dieser feine leise Humor schafft es, dass man selbst schwere Thema leichter …
Mehr
Christoph Poschenrieders Bücher zu lesen, macht einfach Spaß, da sie gut geschrieben sind. Man fliegt durch die Seiten und die Geschichte wächst und wächst. Es ist immer ein Augenzwinkern dabei und dieser feine leise Humor schafft es, dass man selbst schwere Thema leichter erträgt.
In diesem Buch erzählt er die Geschichte von Gustav Meyrink und der Diskussion, wer am ersten Weltkrieg Schuld war bzw. wem man diese Schuld zuschieben kann. Meyrink weiß zunächst nicht so richtig, was er von diesem Angebot, welches vom Auswärtigen Amt kam, halten soll. Doch das Honorar war einfach zu gut, um es nicht doch anzunehmen. Jedoch hat Meyrink seinen eigenen Widerwillen gegen diese Auftragsarbeit unterschätzt und vertrödelt seine Zeit, verprasst seinen Vorschuss und hält das Auswärtige Amt mit fadenscheinigen Antworten auf Abstand.
Die Geschichte wird immer wieder mit Recherchenotizen und Archivbelegen von Christoph Poschrieder untermauert und weitererzählt. Über Meyrinks Vorgehen und seine Gedankengänge musste ich ab und an schmunzeln, wie er sich windet, um seinen Auftrag, den Freimaurern die Schuld zuzuschieben, nicht aufschreiben zu müssen. Denn bewiesen ist nichts und die Angst seinen Ruf zu schädigen ist groß.
Es ist eine wahre Geschichte, die der Autor, in einen anschaulichen und unterhaltsamen Roman verpackt hat. Das Thema ist interessant und man erhält Einblicke in die damalige Politik und deren Vorgehen und Denkweise.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Mitten in einer Séance klopft es an Meyerink’s Türe, gerade als die Apothekerwitwe versucht herauszufinden, wo ihr Liebster den Pfandschein für den Schmuck versteckt hat. Wie so oft kommen die Apothekerrwitwe, ein Bankier, ein Fuhrunternehmer und ein Privatier bei dem …
Mehr
Mitten in einer Séance klopft es an Meyerink’s Türe, gerade als die Apothekerwitwe versucht herauszufinden, wo ihr Liebster den Pfandschein für den Schmuck versteckt hat. Wie so oft kommen die Apothekerrwitwe, ein Bankier, ein Fuhrunternehmer und ein Privatier bei dem Spiritisten Gustav Meyerink im ‘Haus zur letzten Laterne’ am Starnberger See zusammen um mit dem Jenseits Kontakt aufzunehmen,so auch an diesem Tag, was die Störung umso ärgerlicher macht. Vor Meyerink’s Türe steht ein Bote des Auswärtigen Amtes um ihm einen Brief zu überbringen und teilt ihm die Nachricht mit, er solle einen Roman schreiben und zwar darüber, wer am Ausbruch des andauernden Krieges die Schuld und Verantwortung trägt. Meyerink hat in der Vergangenheit bereits einige Romane und Geschichten veröffentlicht, alles phantastische Geschichten wie sein Bestseller ‘Der Golem’, die Realität ist ihm entweder zu langweilig oder zu grässlich, meist sowieso beides, weswegen er sich dieser als Schriftsteller nicht widmen mag. Außerdem, woher soll gerade er wissen, wer schuld ist am I. Weltkrieg?
Viele Wahlmöglichkeiten hat der gute Gustav Meyerink aber nicht, denn zu Papier hat er seit langem nichts mehr gebracht und das Haushaltsbuch spiegelt dieses Desaster wider. Da hilft es auch nicht stundenlang Yogaübungen zu machen. Er muss den Roman also schreiben, denn das Geld wird dringend benötigt. Meyerink nimmt den Auftrag an, erhält einen ordentlichen Vorschuss, womit sein Lebensstil mit Automobil und Segelboot erstmal gesichert ist und beschließt den Freimaurern die schuld am Krieg zu geben. Ein Propagandaroman ist jedoch unvereinbar mit seiner subjektiven Schriftstellerehre und so bleiben die Seiten leer, seinem Bleistift entweicht kein Buchstabe und er beginnt den Auftraggeber geschickt hinzuhalten. Natürlich ist ihm bewusst, dass diese Hinhaltetaktik nicht ewig gut geht, denn am Ende zählen Ergebnisse und leere Blätter dürften nicht ausreichend.
Hauptsächlich berichtet uns Gustav Meyerink als Ich-Erzähler, jedoch sind auch andere Meldungen enthalten, Recherchenotizen, die dem Roman eine gewisse Echtheit verleihen sollen, als hätte Meyerink diesen Roman tatsächlich verfassen sollen. Das Besondere an diesem Roman ist, dass der Autor Fiktion und Realität mischt, denn die Historie, Gustav Meyerink (geb. 19.01.1868 in Wien, gest. 04.01.1932 in Starnberg) und seinen Roman ‘Der Golem’ (1915) gibt bzw. gab es wirklich. Der Leser gerät in einen Strudel um das Dasein des Autors, seiner Geldsorgen, die Hürden und Stolperfallen in seinem Privatleben, die politischen Geschehnisse dieser Zeit in München (und weltweit) und vielem mehr. Durch die Vermischung von Fiktion und Tatsachen ist es ein geniales Verwirrspiel mit uns Lesern, welches ab ca. der Mitte einen wahren Sog entwickelt und irgendwann weiß man gar nicht mehr so recht, was erfunden und was wahr ist. Das Ende ist eine große Überraschung, die Dialoge wahnsinnig gut und voller Wortwitz, eine sehr runde Sache, unterhaltsam, besonders, amüsant und nicht alltäglich.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für