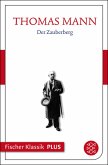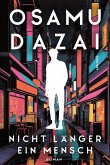Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur Dlf-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Tatsuo Horis Novelle "Der Wind erhebt sich"
Was qualifiziert einen Text eigentlich als "Lektüre zwischen den Jahren"? Wer darüber nachdenkt, wird nicht zwangsläufig, aber ziemlich wahrscheinlich zu dem Schluss gelangen, dass es eine Stimmung der vermischten, widersprüchlichen Empfindungen ist - und ebendie nennt man elegisch: "Die Elegie war sonst ein Werk der Traurigkeit / Allein sie ward hernach zugleich der Lust geweiht", heißt es bereits bei Gottsched.
In diesem Sinne elegisch ist Tatsuo Horis japanische Novelle schon durch ihren Titel und das ihr vorangestellte Motto aus Paul Valérys Gedicht "Le Cimetière marin" (Der Meeresfriedhof), das Tod und Leben, Trauer und Hoffnung vereint, in dem sich die Sonne "auf des Abgrunds Schwingung" stützt und in dem das lyrische Ich am Ende ausruft: "Le vent se lève! . . . Il faut tenter de vivre!" Die Übersetzerin Sabine Mangold bevorzugt vor Varianten wie "Der Wind frischt auf" oder "Der Wind hebt sich" die noch aktivischere: "Der Wind erhebt sich, nun gilt es zu leben." Diese scheint vorderhand auch zur beseelten Natur in Tatsuo Horis kurzem Werk zu passen. "Kaze tachinu", im Original erschienen 1937/38 in der Zeitschrift "Kaizo", hat in Japan schon eine beachtliche Wirkungsgeschichte, ist mehrfach filmisch adaptiert worden und inspirierte Hayao Miyazakis gepriesenes Anime "Wie der Wind sich hebt" (F.A.Z. vom 17. Juli 2014), wird hier aber erstmals ins Deutsche übertragen.
Die Novelle beginnt mit einem eindrücklichen Bild, das den Vorrang des Lebens gegenüber der Kunst zu beschwören scheint: Zwei Liebende liegen im Sommer im "üppig wuchernden Pampasgras" unter einer Birke und naschen Früchte. Die Frau hat dort eben noch an einer Staffelei gemalt, der Mann sie beobachtet. Als der Wind die Staffelei umwirft, springt die Frau auf, doch der Mann hält sie fest, "damit du bei mir bleibst und nichts verlorengeht in diesem Augenblick".
Aber schon wenig später wird diese Idylle zerstört, hat die Frau eine "überraschende Nachricht" (hinter der sich eine Krankheit zum Tode verbirgt, wie sich langsam herausstellt) und hat der Herbst "den Wald bis zur Unkenntlichkeit verwüstet". Tatsuo Hori stellt Sprachbilder der vergänglichen Schönheit flirrender Licht- und Wolkenspiele neben kühl-sachliche Erkenntnissätze, die den Leser schaudern lassen. Das Romantische des Textes erweist sich bald auch als abgründig: Der Mann, der die Geschichte selbst erzählt, gesteht seiner Verlobten Setsuko, "dass es gerade deine Zerbrechlichkeit ist, die meine Liebe zu dir noch verstärkt". Aus dem Traum eines gemeinsamen Lebens in einer Berghütte wird die Realität eines Lebensendes im Sanatorium; die vorläufige Besserung schlägt um ins Gegenteil.
Zudem wird die Erzählung immer rätselhafter. Ihre Chronologie scheint durcheinanderzugeraten, und über den Mann des Paares, der zugleich der Erzähler ist, erfährt man aus Setsukos Mund, er phantasiere "manchmal die unglaublichsten Dinge". Dass dieser Mann selbst Schriftsteller ist, der während des Sanatoriumsaufenthalts mit seiner Frau an einem neuen Werk arbeitet, lässt seine Wünsche immer zweifelhafter werden ("beim Schreiben möchte ich dich überglücklich erleben") und gibt dem Text eine metafiktionale Ebene - verstärkt noch durch die Information, dass Tatsuo Hori (1904 bis 1953) zeitlebens von Sanatoriumserzählungen fasziniert war, dass er selbst an Tuberkulose erkrankte und daran starb.
Der Text endet mit den Tagebucheinträgen eines Schriftstellers am Ende eines Jahres, der sich intensiv mit Rainer Maria Rilkes "Requiem für eine Freundin" auseinandersetzt. Am 30. Dezember ist er ganz allein in einer einsamen japanischen Berghütte, scheinbar zufrieden in dieser "Oase der Ruhe", allerdings wird der draußen sich erhebende Wind bald zu einem heulenden, der nur noch tote Blätter aufwirbelt. So hinterlässt die Novelle am Ende, im starken Gegensatz zu ihrem Anfangsbild, die Frage, ob hier vielleicht die Kunst das Leben besiegt hat. Ob gerade darin auch ihre moralische Warnung und damit größte Wirkung auf die zwischen den Jahren, zwischen existenziellen Gewichtungen balancierende Seele des Lesers liegen könnte? JAN WIELE
Tatsuo Hori:
"Der Wind erhebt sich". Novelle.
Aus dem Japanischen von Sabine Mangold. Mitteldeutscher
Verlag, Halle 2022.
86 S., geb., 16,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main