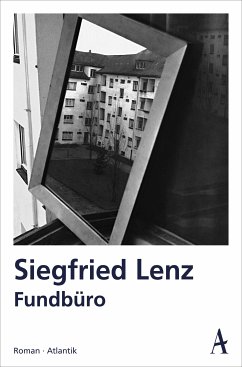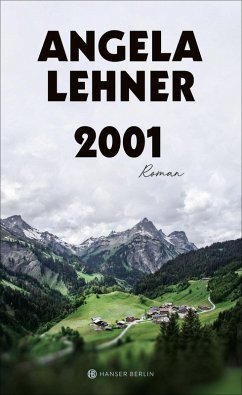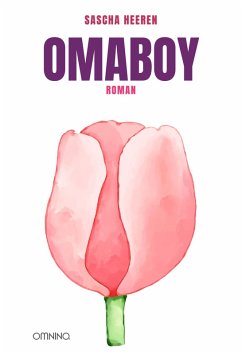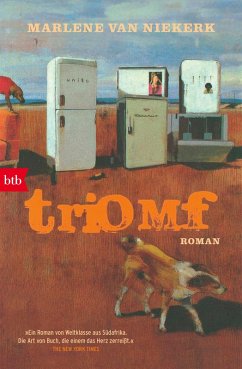Der Winter tut den Fischen gut (eBook, ePUB)
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 25,00 €**
12,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Was haben Miranda July, Markus Werner und Wilhelm Genazino gemeinsam? Lesen Sie dieses Buch und Sie wissen es. Maria hat Zeit. So sitzt sie tagsüber oft auf einer Bank am Platz vor der Kirche, beobachtet das Treiben dort, ein Kommen und Gehen, Leute, die Ziele haben und wenig Zeit. Die arbeitslose Textilfachverkäuferin kennt sich mit Stoffen aus, weiß, was zueinander passt, was Schwächen kaschiert und Vorzüge betont. In ihrem Fall ist das schwieriger: Welcher Vorzug macht ihr Alter vergessen für einen Markt, der sie nicht braucht? Alt ist sie nicht, aber ihr Leben läuft trotzdem rückw�...
Was haben Miranda July, Markus Werner und Wilhelm Genazino gemeinsam? Lesen Sie dieses Buch und Sie wissen es. Maria hat Zeit. So sitzt sie tagsüber oft auf einer Bank am Platz vor der Kirche, beobachtet das Treiben dort, ein Kommen und Gehen, Leute, die Ziele haben und wenig Zeit. Die arbeitslose Textilfachverkäuferin kennt sich mit Stoffen aus, weiß, was zueinander passt, was Schwächen kaschiert und Vorzüge betont. In ihrem Fall ist das schwieriger: Welcher Vorzug macht ihr Alter vergessen für einen Markt, der sie nicht braucht? Alt ist sie nicht, aber ihr Leben läuft trotzdem rückwärts, an seinen Möglichkeiten, Träumen und Unfällen vorbei: Otto, den sie im Gemüsefach vergisst, Walter, den Elvis-Imitator von der traurigen Gestalt, der sie zur Witwe macht, Eduard, der mit einer anderen aus der Stadt zurückkehrt, ihre kleinere Schwester, die sosehr Mutter ist, dass sie Maria wie ein Kind behandelt. In solchen Geschichten um solche Menschen, liebenswert in ihrer skurrilen Versponnenheit, entwirft Anna Weidenholzer ein Bild von einer Frau am Rande der Gesellschaft. Und das ist immer noch mitten im Leben.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.