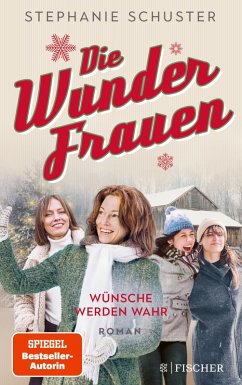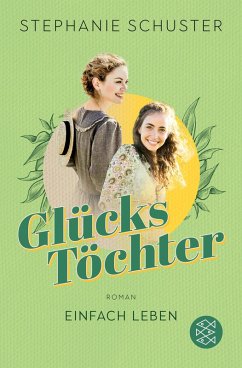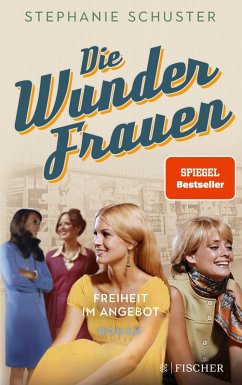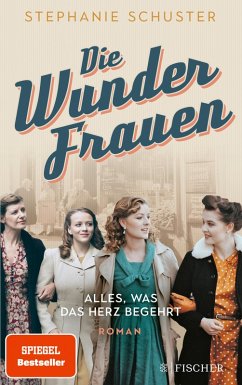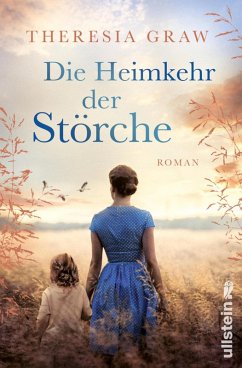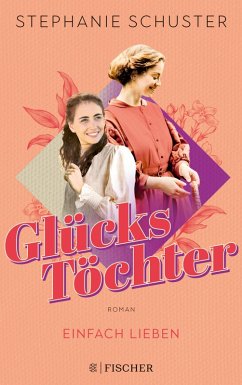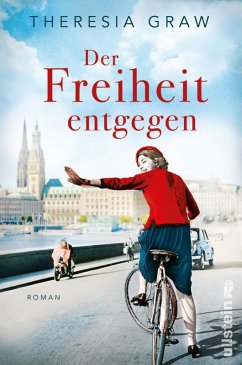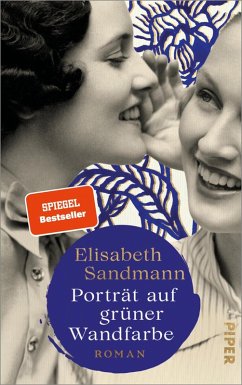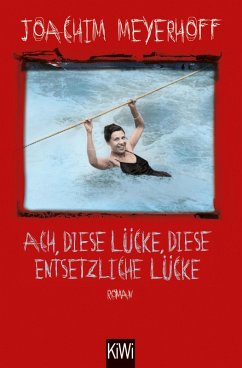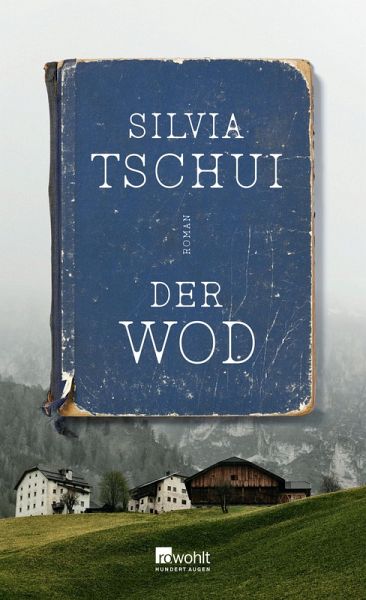
Der Wod (eBook, ePUB)
Sofort per Download lieferbar
Statt: 22,00 €**
9,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Ein leise und bös dahergesagter Satz auf einer Feier zum Fünfundsiebzigsten führt zu Herzinfarkt und Blutvergießen. Denn Jahrzehnte zuvor, auf der Flucht zweier kleiner Brüder aus Mecklenburg zu Kriegsende, ist etwas geschehen, das nicht vergessen, nie vergeben wurde. Und ein Unglück zeugt das nächste in der schweizerisch-deutschen Familie, um deren Geschichte es hier geht. Der Roman spannt einen Bogen über Epochen und Ländergrenzen hinweg, erzählt vielstimmig und mit regionalen und historischen Sprachfärbungen viel Welt: von einer Druckerei in Mecklenburg, der Uhrenmanufaktur in de...
Ein leise und bös dahergesagter Satz auf einer Feier zum Fünfundsiebzigsten führt zu Herzinfarkt und Blutvergießen. Denn Jahrzehnte zuvor, auf der Flucht zweier kleiner Brüder aus Mecklenburg zu Kriegsende, ist etwas geschehen, das nicht vergessen, nie vergeben wurde. Und ein Unglück zeugt das nächste in der schweizerisch-deutschen Familie, um deren Geschichte es hier geht. Der Roman spannt einen Bogen über Epochen und Ländergrenzen hinweg, erzählt vielstimmig und mit regionalen und historischen Sprachfärbungen viel Welt: von einer Druckerei in Mecklenburg, der Uhrenmanufaktur in der Schweiz, von Geheimgesellschaften und Künstlerkreisen, Nazis und Widerständlern, Großbürgern und Hell's Angels, Feigheit und Mut, Krieg und Vertreibung, Geheimnisse, Lügen, Tod und Neubeginn,. Und immer wieder ist da der titelgebende Wod, der wilde Jäger aus der norddeutschen Sage, über den man ungestraft nicht spottet, denn sonst lässt er einen ein Leben lang nicht los ...
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.