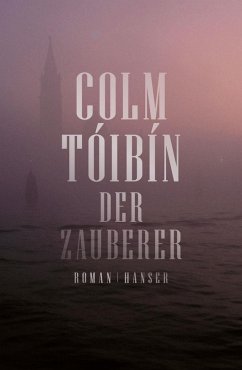Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, L ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Literarische Freiheit oder übergriffige Indiskretion? Colm Tóibíns Thomas-Mann-Roman "Der Zauberer"
Er habe gelacht, aber unter seinem Niveau - zu einem solchen literarischen Urteil, waghalsig balancierend zwischen unverhohlenem Eigenlob und feiner Selbstironie, war nur Marcel Reich-Ranicki in der Lage. Wichtiger aber ist das Lektürephänomen, das er mit seinem witzigen Aperçu auf den Punkt brachte: nämlich das, sich von einem Buch unterhalten zu lassen, obwohl man sich völlig im Klaren darüber ist, dass eigentlich alles daran dagegen spricht. Genauso mag es einem bei der Lektüre des neuen, am Montag erscheinenden Romans von Colm Tóibín ergehen, der auf über 500 Seiten die Lebensgeschichte Thomas Manns erzählt, in all its completeness, von den Anfängen in Lübeck und München über die Exiljahre in Princeton und Pacific Palisades bis zu den letzten Tagen im schweizerischen Kilchberg.
Der erste Eindruck: Auf so eine Idee kann nur ein Ire, jedenfalls ein mit dem hiesigen Buchmarkt nicht allzu vertrauter Schriftsteller kommen. Und tatsächlich richtet sich Tóibín zunächst an eine anglophone, sicher auch internationale Leserschaft, die vom Zerfall der hanseatischen Bürgerwelt, dem erbitterten Bruderstreit zwischen Thomas und Heinrich, dem publizistischen Kampf gegen Hitler meist wohl nur Sporadisches weiß. Hierzulande scheint der Markt hingegen so übersättigt mit Biographien und Bildbänden über Thomas Mann und die Seinen, dass man seine Lesezeit besser zubringen kann als mit dem "Zauberer", vorzugsweise mit dessen späten Erzählungen, die jüngst im Rahmen der "großen kommentierten Frankfurter Ausgabe" der Werke Thomas Manns in einer genialen Neuedition erschienen sind.
Und wo gerade die Rede von modernem Erzählen ist: Es verblüfft schon sehr, wie bruchlos, wie frei von jeder Infragestellung Tóibín das Leben Thomas Manns ins literarische Werk setzt. Wo etwa Heinrich Breloer in seinem vielgesehenen Fernsehdreiteiler "Die Manns" beständig hin und her wechselt zwischen Zeitzeugen-Interviews, historischen Aufnahmen und nachgestellten biographischen Szenen, um so das Bewusstsein für den Konstruktionscharakter seiner Annäherung wachzuhalten, entfaltet "Der Zauberer" eine makellose Illusion, die vorgibt, Thomas Mann hätte so und nicht anders gelebt, gedacht, gefühlt, ja sogar geträumt. Auf diesem Wege, und verstärkt noch durch einen persönlichen, immer wieder intimen Erzählton, schiebt Tóibín seinen Lesern eine psychologische Gesamtinterpretation unter: Im Zweifelsfall steht für ihn hinter allem Denken, Handeln und Schreiben Thomas Manns dessen sorgsam verborgene Homosexualität - ein Konflikt, den er bereits in seinem Roman über den späten Henry James, "The Master" betitelt, ähnlich in den Mittelpunkt gestellt hat.
Was nicht passt, wird passend gemacht
Dabei geht Tóibín bisweilen so weit, die Leerstellen der biographischen Überlieferung kurzerhand durch seine Imagination zu füllen. Konkret geschieht dies im Falle der frühen Tagebücher, die Thomas Mann vor dem Gang ins Schweizer Exil in München zurücklassen musste, bangend, dass die Nazis sie in die Hände bekommen würden, denn so wäre deutlich geworden, "wer er wirklich war und wovon er träumte . . ., dass sein distanzierter gelehrter Ton, seine steife Förmlichkeit, sein Interesse an Ehrungen und Hofiertwerden lediglich Masken waren, die niedere sexuelle Begierden unkenntlich machen sollten". Bis in einzelne Details hinein schildert Tóibín, was in den Journalen an Skandalösem vermeintlich zu lesen war: "Es musste ein paar weitere Einträge geben, in denen er von Klaus' Körper sprach oder davon, wie sehr ihn der Anblick von Klaus in seinem Badeanzug erregte." Ist das noch literarische Freiheit, begründetes Dazuerfinden oder schon übergriffige Indiskretion?
Die Folgen dieser thematischen Akzentuierung sind jedenfalls weitreichend, denn sie führt dazu, dass alles, was nicht unmittelbar in den eng umrissenen Deutungsrahmen passt, nur der Vollständigkeit halber miterwähnt wird. Der gigantische Josephsroman etwa wird nur ein einziges Mal namentlich genannt, gerade so, als wären die vier Bände beiläufig entstanden, während gleichzeitig "Der Tod in Venedig" zum eigentlichen Hauptwerk erkoren wird. Und auch der politische Thomas Mann, dessen Überzeugungen in Tóibíns Lesart meist nur von außen an ihn herangetragene Fremdmeinungen sind, gerät unter die erzählerischen Räder des Romans: Der chauvinistische Nationalismus, sein Eintreten für Kaiser und Krieg? Habe ihm sein damaliger Freund und Bewunderer Ernst Bertram eingeflüstert. Manns Plädoyer für die Weimarer Republik in den Zwanzigerjahren? Eine Gefälligkeit, die er mürrisch seiner Frau Katia erwiesen habe. Sein Verhalten gegenüber Präsident Roosevelt? Beruhte auf Ratschlägen seiner Förderin Agnes E. Meyer (die bei Tóibín allerdings erfreulich selbstbewusst und witzig auftritt, während sie anderswo oft nur als unterwürfig, anstrengend, letztlich peinlich erscheint).
Ein zeitgemäß menschelndes Porträt mit witzigen Momenten
Das, was einen an Thomas Mann bis heute faszinieren kann, seine anhaltende Kraft zur gedanklichen Selbstrevision, die sich in den Vereinigten Staaten noch einmal stark intensivierte - für Tóibín entspräche so etwas wohl einer nachträglichen Verklärung. Folgt man ihm, war Mann ein politisch durchaus unselbständiger Denker, dem es stets mehr um Anerkennung und Resonanz als um Haltungen und Positionierung ging. In letzter Konsequenz führt dies dazu, dass er einen Protagonisten des zwanzigsten Jahrhunderts zu einem in sich selbst gefangenen, von Eitelkeit getriebenen Normalmenschen verzwergt. Es ist ein nahbares, zeitgemäß menschelndes, aber auch reduktionistisches und vor allem wenig originelles Porträt, das Tóibín zeichnet: Erinnert man sich noch an Hans Pleschinskis vor einigen Jahren erschienenen Roman "Königsallee", der von einer fiktiven Begegnung des alten Thomas Mann mit seiner früheren Liebe Klaus Heuser erzählte?
Was Tóibíns Werk demgegenüber auszeichnet, sind immerhin einige reizvolle Erzählmomente. So etwa die sensible Aufmerksamkeit für Julia Mann, die aus Brasilien stammende Mutter Thomas Manns, und ihr anhaltendes Fremdsein im kalten, nebelverhangenen Lübeck. Ihre Geschichte ist in der Tat noch lange nicht auserzählt. Erwähnenswert sind außerdem ein paar komische Episoden, die vom Versuch des Ehepaars Mann berichten, sich die englische Sprache anzueignen, zunächst und kurioserweise unter Anweisung eines italienischen Lehrers, der seinen Schülern ausgerechnet Dantes "Inferno" in englischer Übersetzung als Lehrbuch vorlegt. Irgendwann stellt Katia belustigt zu ihrem Englischunterricht fest, der ja einen tiefernsten Zweck, nämlich die Vorbereitung auf ihr Leben im Fluchtland Amerika hat: Mit Dante komme sie mittlerweile gut zurecht, "die Hälfte der Reise und der finstre Wald, und was da sonst noch alles ist", aber das helfe ihr nicht weiter, wenn sie "im Gemüseladen Möhren kaufen oder dem Klempner erklären will, dass ein Hahn tropft". Man müsse jetzt unbedingt, Hochkultur hin oder her, richtiges amerikanisches Englisch lernen.
Schließlich bietet der Roman denjenigen Lesern eine spielerische Freude, die sich in Thomas Manns Erzählwerk ein wenig auskennen. Die Erdbeeren, die Katia und ihrem Mann am italienischen Strand von einem Händler angeboten werden, weist diese mit den Worten "Die sind nicht einmal gewaschen!" resolut zurück. Katia wird so als eine Schutzinstanz erkennbar, die ihrem Ehemann vor eben jenem Schicksal bewahrt, das Gustav von Aschenbach in der Novelle zu erleiden hat - und dies gilt beileibe nicht bloß in gesundheitlicher Hinsicht.
Trotz dieser Passagen und Szenen scheitert "Der Zauberer" als Biographie wie auch als Roman: als Biographie, weil dem Buch schlicht die sachliche Ausgewogenheit fehlt, und als Roman, weil es weit unter den Möglichkeiten der Gattung bleibt. Stattdessen erweckt Tóibíns Buch den Eindruck, es handele sich um die Grundlage für eine kommende Streaming-Serie, deren souveränes Storytelling, raffinierte Dialogführung und komplexe Figurenzeichnung uns sicher glänzend unterhalten würden. Nur wäre der Preis dafür deutlich zu hoch. KAI SINA
Colm Tóibín:
"Der Zauberer". Roman.
Aus dem Englischen von Giovanni Bandini. Carl Hanser Verlag, München 2021. 560 S., geb. 28,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main