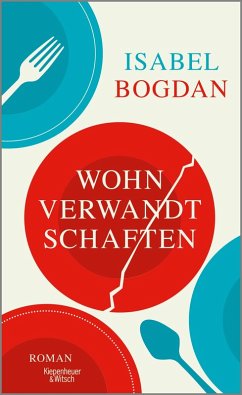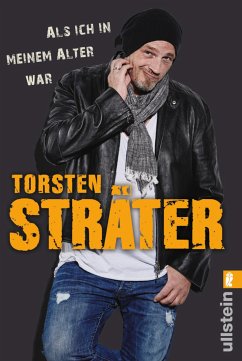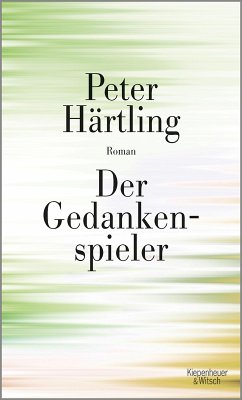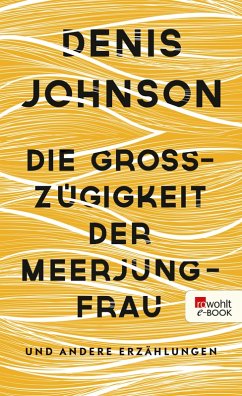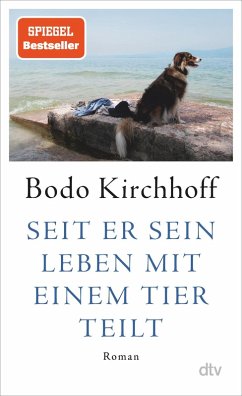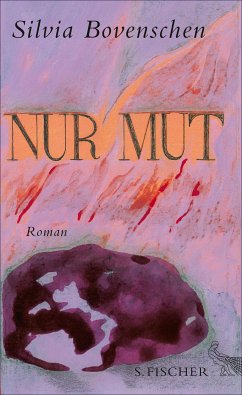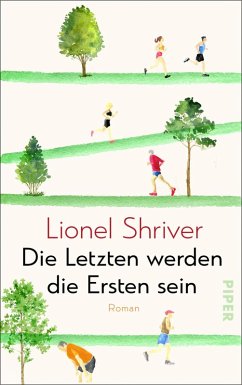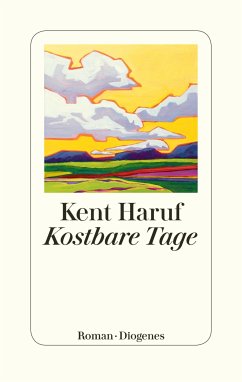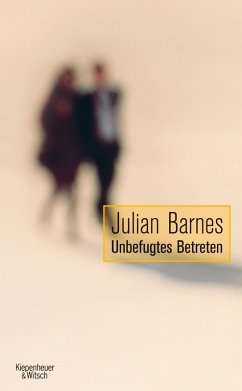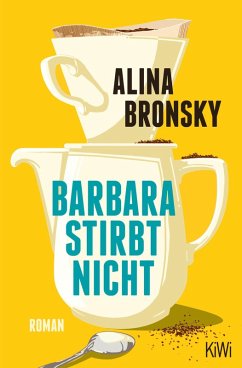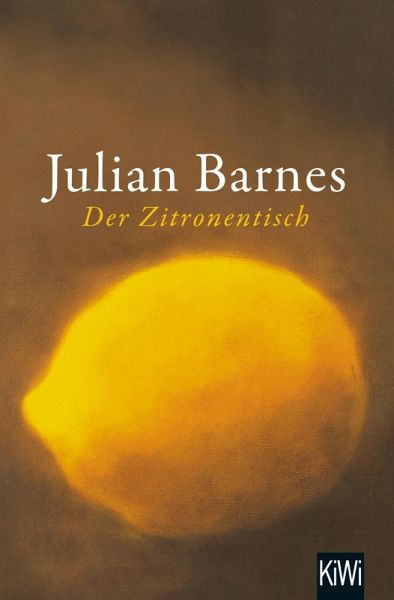
Der Zitronentisch (eBook, ePUB)
Erzählungen
Übersetzer: Krueger, Gertraude
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 18,90 €**
9,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
»Erzählungen von großer Meisterschaft, mit Witz, mit Tempo, mit Frechheit« Elke Heidenreich Julian Barnes wird immer wieder gepriesen für seine stilistische Brillanz, für die scharfe Beobachtungsgabe, die Ironie und den oft schwarzen Humor. Der Erzählungsband mit dem geheimnisvollen Titel Der Zitronentisch zeigt Julian Barnes in seiner ganzen Meisterschaft. Jede Erzählung steht für sich, doch sind alle durch das Thema miteinander verbunden - das Altern. Ob die Erzählungen nun im 19. Jahrhundert oder in unserer Zeit spielen, die Menschen nähern sich dem Ende ihres Lebens, dem Ende, d...
»Erzählungen von großer Meisterschaft, mit Witz, mit Tempo, mit Frechheit« Elke Heidenreich Julian Barnes wird immer wieder gepriesen für seine stilistische Brillanz, für die scharfe Beobachtungsgabe, die Ironie und den oft schwarzen Humor. Der Erzählungsband mit dem geheimnisvollen Titel Der Zitronentisch zeigt Julian Barnes in seiner ganzen Meisterschaft. Jede Erzählung steht für sich, doch sind alle durch das Thema miteinander verbunden - das Altern. Ob die Erzählungen nun im 19. Jahrhundert oder in unserer Zeit spielen, die Menschen nähern sich dem Ende ihres Lebens, dem Ende, das sich in besonderen Erfahrungen und oft irrwitzigen Situationen ankündigt. Sie gehen damit gelassen um oder aufbegehrend, resigniert oder bitter. Die Zitrone, erfährt der Leser in der letzten Erzählung Stille, ist für die Chinesen das Symbol des Todes. In dieser Erzählung über den ausgebrannten Komponisten Sibelius treffen sich die alten Männer an einem (nicht Stamm-, sondern) Zitronentisch, um über ihr Ende zu sprechen: »Kopf hoch! Der Tod ist nicht mehr fern.« Julian Barnes erhielt 2004 den Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur. Der Preis wurde im August 2005 verliehen.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.