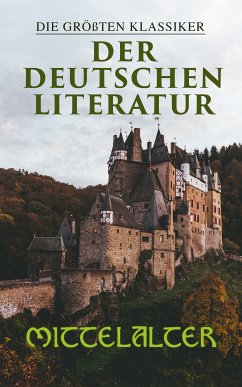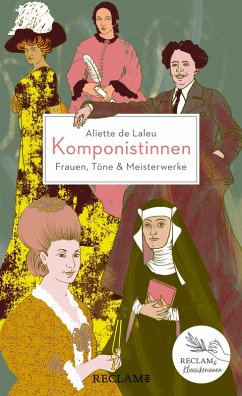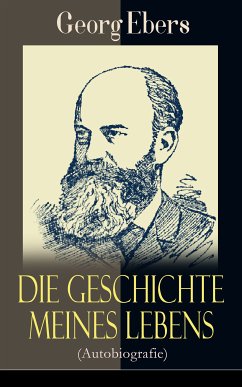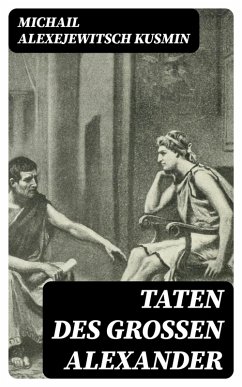Des Reiches genialste Schandschnauze (eBook, ePUB)
Texte und Briefe zu Walther von der Vogelweide
Redaktion: Opitz, Stephan
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 19,90 €**
15,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Peter Rühmkorf und Walther von der Vogelweide: eine freundschaftliche Annäherung zweier großer Lyriker über die Jahrhunderte hinweg, erzählt anhand von Gedichten, Briefen und Tagebuchnotizen. Peter Rühmkorf fand in den 1970er Jahren eine erstaunliche und für sein weiteres literarisches Werk bedeutsame Nähe zu Walther von der Vogelweide. Davon erzählt dieses Buch. Rühmkorfs Anverwandtschaft über einen Zeitraum von acht Jahrhunderten hinweg zeigt sich in seinen Übersetzungen der mittelhochdeutschen Gedichte Walthers von der Vogelweide, »des Reiches genialster Schandschnauze«. Paral...
Peter Rühmkorf und Walther von der Vogelweide: eine freundschaftliche Annäherung zweier großer Lyriker über die Jahrhunderte hinweg, erzählt anhand von Gedichten, Briefen und Tagebuchnotizen. Peter Rühmkorf fand in den 1970er Jahren eine erstaunliche und für sein weiteres literarisches Werk bedeutsame Nähe zu Walther von der Vogelweide. Davon erzählt dieses Buch. Rühmkorfs Anverwandtschaft über einen Zeitraum von acht Jahrhunderten hinweg zeigt sich in seinen Übersetzungen der mittelhochdeutschen Gedichte Walthers von der Vogelweide, »des Reiches genialster Schandschnauze«. Parallel dazu schrieb Rühmkorf einen auch literaturwissenschaftlich bemerkenswerten Essay über den »Reichssänger und Hausierer«, für den er sich von dem bedeutenden Mediävisten Peter Wapnewski Rat holte. Der Briefwechsel zwischen Dichter und Wissenschaftler, in dem sie über den >richtigen< Zugang zu Walther streiten, wird hier dem Essay zur Seite gestellt. Die Beschäftigung mit dem mittelalterlichen Dichterkollegen half Rühmkorf auch bei der Überwindung seiner >poetischen Krise<: Erstmals nach zehn Jahren entstanden um 1975 wieder eigene Gedichte. Diesen Zusammenhang belegen Passagen aus den unpublizierten Tagebüchern Rühmkorfs, die in diesem Band auszugsweise dokumentiert sind.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.