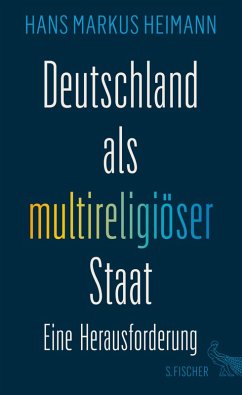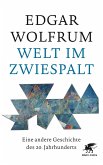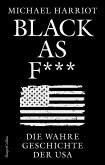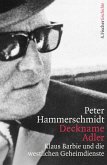Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Juristisches Tischfeuerwerk: Hans Markus Heimann will Konflikte unserer multireligiösen Gesellschaft durch grundrechtliche Güterabwägungen gelöst sehen.
In Deutschland sind religionspolitische Fragen und interreligiöse Konflikte immer auch Fragen des Rechts, mehr als in anderen Staaten. Also fallen sie in die Zuständigkeit der Juristen, besonders der Verfassungsjuristen. Warum das so ist, hat historische Gründe. Im konfessionell gespaltenen Deutschland fiel dem Recht die dauernde Aufgabe zu, als neutrale Instanz die politische Verständigung zwischen den Kirchen und dem Staat zu organisieren. Nach dem Ende des landesherrlichen Kirchenregiments schuf dann die Weimarer Verfassung das Modell einer "hinkenden Trennung" von Staat und Kirche, das sich bis heute, wie man in zeitloser Technizität zu sagen pflegt, in Geltung befindet.
Zwar sind die Religionsgesellschaften danach vom Staat institutionell getrennt, doch dürfen sie mit ihm in vielfacher Hinsicht zusammenwirken: im Religionsunterricht, in den Theologischen Fakultäten oder bei der Erhebung von Kirchensteuern. Konfliktanfällig sind beide Bereiche, die religiöse Autonomie wie die gemeinsamen Angelegenheiten. Hier wird darum gestritten, inwiefern der Staat die bekenntnisgebundenen Lehrinhalte des Religionsunterrichts überwachen darf, dort darum, ob etwa das kirchliche Arbeitsrecht die sittliche Lebensführung sanktionieren kann.
Dieser vom Grundgesetz übernommene Verfassungskompromiss ist, und das macht ihn aus, durch einen doppelten Ursprung beglaubigt. Nach dem Ersten Weltkrieg waren die Kirchen in der Defensive, nach dem Zweiten gaben sie eine Zeitlang politisch den Ton an. Schon deshalb taugt aber das Bild eines intakten Volkskirchentums nicht als historische Folie zum Verständnis des deutschen Staatskirchenrechts. Nicht nur in dieser Hinsicht fehlt es dem Buch von Hans Markus Heimann, das ohne eine einzige prägnante These auskommt, an Unterscheidungsvermögen. Seine pauschale Entgegensetzung der neuen religiösen Kräfte einerseits und der christlichen Großkirchen andererseits erklärt bei näherer Betrachtung reichlich wenig. Denn gerade in ihrem Verhältnis zum Staat unterscheiden die Konfessionen sich ja erst seit neuestem nicht mehr fundamental voneinander.
Niemand bestreitet, dass die massiven religionssoziologischen Verschiebungen der letzten Jahrzehnte das überkommene deutsche Religionsverfassungsrecht vor neue Herausforderungen stellen. Dass aber dessen Regeln in dieser neuen Lage ihre Berechtigung schon deshalb verlieren, weil sie für eine andere Lage gedacht waren, ist ein Kurzschluss. Warum sollte ein überkommenes Normengefüge nicht einer neuen Begründung und Aufgabe fähig sein? Das zeigt sich gerade bei der Bewältigung der vielen gegenwärtigen Konfliktfelder. Dürfen islamische Glaubensgemeinschaften an staatlichen Schulen Religionsunterricht erteilen? Kann islamische Theologie an Universitäten gelehrt werden? Muss die religiös motivierte Beschneidung gesetzlich erlaubt, darf sie bestraft werden? Ist der Tatbestand der Religionsbeschimpfung verfassungsrechtlich gerechtfertigt?
Was Heimann als Lösung solcher und anderer Streitfragen einer multireligiösen Gesellschaft anbietet, ist weniger eine sorgfältige Abschichtung der Probleme als eine Phantasie verfassungsjuristischer Vernunft, der zufolge jeder Konflikt durch eine umfassende grundrechtliche Güterabwägung angemessen zu lösen ist. Alle Belange und Interessen genießen irgendwie Grundrechtsschutz, und es kommt nur noch darauf an, sie richtig gegeneinander zu gewichten. Nichts bedarf der Überlegung, nichts der demokratischen Gestaltung, alles scheint verfassungsrechtlich ermittelbar.
Das ist es aber nicht, wie das Kapitel über den Religions- und Ethikunterricht zeigt. Gerade auf diesem Feld erproben die Länder ja seit Jahren die vielfältigen Handlungsoptionen, die das geltende Recht bietet. Ausgang offen. Doch mit den konkurrierenden Modellen und ihren Vor- und Nachteilen hält sich Heimann nicht lange auf, sondern zündet stattdessen juristisches Tischfeuerwerk in Form seitenlanger abstrakter Erwägungen über widerstreitende Verfassungsprinzipien, um etwa zu beweisen, dass im Ethikunterricht nur die "kritische Reflexion von Moralsystemen", nicht aber die Unterweisung in einem bestimmten Moralsystem zulässig ist. Mit Ausnahme des Wertesystems der Verfassung, versteht sich.
Womit sich dieser Ansatz am Ende widerlegt, sind seine Konsequenzen, die Heimann aber nicht selbst zieht. Er läuft hinaus auf die restlose Verstaatlichung aller religiösen Konflikte, um nicht zu sagen: auf ein bürokratisches Religionsregiment. Es entsteht das Bild einer multireligiösen Gesellschaft, die ihre Konflikte im völlig unpolitischen Modus von einer Verwaltung austragen lässt, die mit Hilfe abwägender Verfassungsauslegung allseits verträgliche Lösungen vorgibt. Das gipfelt in der Kritik an den angeblich vordemokratischen Verträgen zwischen dem Staat und den Glaubensgemeinschaften, in denen so unterschiedliche Dinge geregelt sein können wie die Ausgestaltung Theologischer Fakultäten, Kirchenbaulasten oder die Mitwirkung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Solche Vereinbarungen haben, wie Julia Lutz-Bachmann jüngst in einer höchst lesenswerten Studie gezeigt hat, in der veränderten religiösen Landschaft nicht etwa ihre Berechtigung verloren, sondern ihre große Aufgabe vielleicht noch vor sich. Wem freilich die institutionelle Autonomie der Religion gegenüber dem Staat überhaupt verdächtig ist, wird nicht erkennen, dass gerade in jener organisierten Selbständigkeit die große Chance und Leistungsfähigkeit des deutschen Religionsverfassungsrechts liegt.
FLORIAN MEINEL
Hans Markus Heimann: "Deutschland als multireligiöser Staat". Eine Herausforderung.
S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2016. 248 S., geb., 22,99 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main