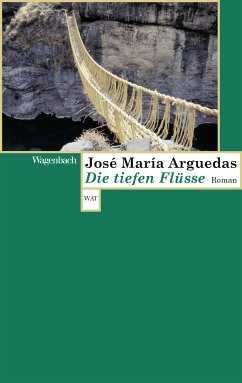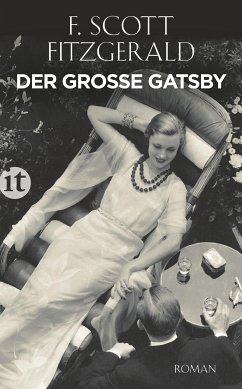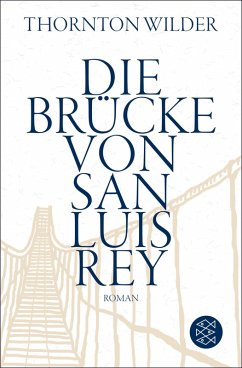Dich zu verlieren oder mich (eBook, ePUB)
Die Geschichte einer afghanischen Mutter
Übersetzer: Kemper, Eva

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Wie weit gehst du, um dir treu zu bleiben? - Die wahre Geschichte einer afghanischen Mutter in ihrem Kampf für Gleichberechtigung Homeira ist kein gewöhnliches afghanisches Mädchen. Mit dreizehn riskiert sie ihr Leben, um andere Mädchen heimlich zu unterrichten. Sie liest jedes Buch, das sie finden kann, am liebsten die russischen Klassiker ihres Vaters, die er zum Schutz vor den Taliban unter einem Maulbeerbaum vergräbt. Als eine ihrer Kurzgeschichten in der Zeitung veröffentlicht wird, glaubt Homeira, als Frau in Afghanistan glücklich werden zu können. Doch als sich Jahre später ihr...
Wie weit gehst du, um dir treu zu bleiben? - Die wahre Geschichte einer afghanischen Mutter in ihrem Kampf für Gleichberechtigung Homeira ist kein gewöhnliches afghanisches Mädchen. Mit dreizehn riskiert sie ihr Leben, um andere Mädchen heimlich zu unterrichten. Sie liest jedes Buch, das sie finden kann, am liebsten die russischen Klassiker ihres Vaters, die er zum Schutz vor den Taliban unter einem Maulbeerbaum vergräbt. Als eine ihrer Kurzgeschichten in der Zeitung veröffentlicht wird, glaubt Homeira, als Frau in Afghanistan glücklich werden zu können. Doch als sich Jahre später ihr Mann nach der Geburt ihres Sohnes eine Zweitfrau nehmen will, weiß sie, dass das niemals gelingen kann. Homeira steht vor einer unmöglichen Entscheidung: Revoltiert sie und verliert ihren Sohn, oder lässt sie es geschehen und verliert sich selbst? In ihrem Buch verwebt sie Erinnerungen mit bewegenden Briefen an ihren Sohn, den sie zunächst zurücklassen musste. Homeiras Geschichte ist die einer bemerkenswerten afghanischen Frau - und die einer Mutter zwischen Liebe und dem Wunsch nach Freiheit.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.