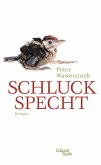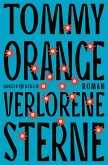Nina Bußmann erzählt von drei Menschen in der Großstadt, die um Kontrolle kämpfen, sie aber längst verloren haben. In prekäre Arbeits- und Lebensverhältnisse verstrickt, taumeln sie zwischen Abhängigkeiten und Freundschaften, Therapieversprechen und spirituellen Verlockungen. Ohne Rausch kommt kaum einer aus. Und dennoch suchen sie alle nach Klarheit.
»In Nina Bußmanns Büchern ist es die Genauigkeit der Beschreibung, die die Unschärfen des Lebens erkennbar macht.« Paul Jandl, Neue Zürcher Zeitung
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Nina Bußmanns Roman "Dickicht"
Wie kleine, unbemerkte Risse in einer angeknacksten Eierschale, heißt es zu Beginn von Nina Bußmanns Roman "Dickicht", müsse man sich vorstellen, was in der Kristallographie eine Störung genannt werde - "eine Unregelmäßigkeit in der Gesamtstruktur, Verwerfungen, die unter normalen Bedingungen unbemerkt bleiben". Solch kaum wahrnehmbare Störungen können auch eine Biographie unvermutet kollabieren lassen, wenn der Druck auf die beschädigte Struktur zu hoch wird. Diese Risse interessieren die 1980 geborene Autorin - ebenso wie die Versuche, sie zu kitten. Und deren Scheitern.
Ist es in Bußmanns Debütroman "Große Ferien" (2012) ein Lehrer, der nach einem Zwischenfall nicht mehr unterrichten darf, und in "Der Mantel der Erde ist heiß und teilweise geschmolzen" (2017) eine junge Geologin, die spurlos in Nicaragua verschwindet, so sind es im neuen Roman drei Figuren in einer namenlosen Großstadt, die keinen Halt im Leben finden, ohne dass man genau wüsste, was der Grund hierfür ist.
Und vielleicht würde, aus der im großstädtischen Umfeld üblichen Distanz betrachtet, jemand wie Katja auch gar nicht in ihrem Trudeln wahrgenommen werden. Ihre Ehe mit dem gutsituierten Milan mag scheitern, zwischenzeitlich leidet sie an kreisrundem Haarausfall. Eigentlich aber ist Katja diejenige, die Rat für andere zu haben meint. Eine wenn auch unrealisierte Geschäftsidee von ihr ist etwa, Menschen beim Aufräumen und Ordnen des Lebens zu helfen, damit sie kein Chaos hinterlassen.
Auch jenseits beruflicher Sphären kümmert Katja sich um andere. Zum Beispiel um die ältere Ruth, die zweite Hauptfigur von "Dickicht", die nach einem Sturz im Park zunächst im Krankenhaus liegt und nach ihrer Entlassung eigentlich noch gar nicht wieder in der Lage ist, eigenständig ihren Alltag zu organisieren.
Wie genau es zu Ruths Unfall gekommen ist, ob ein kleines Rudel Hunde ihr die Beine weggerissen hat oder ob ihre Alkoholsucht der eigentliche Auslöser ist, lässt Nina Bußmann offen. Ebenso wie im Vagen bleibt, ob Ruth sich tatsächlich gegen Katjas Willen zunächst in deren Wagen, hernach in deren Wohnung drängt oder ob Katja dankbar ist für diese sinnstiftende Aufgabe. Das Kümmern um andere muss nicht zwingend selbstlos sein, es dient auch zur Selbstversicherung oder gar -erhebung. Das Gefühl, gebraucht zu werden, kann Ablenkung genauso wie verkappter Narzissmus sein.
Bleibt Max, der sein Studium abbricht, auch das ohne erkennbaren Grund, um fortan als Praktikant in einem Kindergarten zu arbeiten, neben seinem Engagement gegen Gentrifizierung. Dort lernt er Ruth kennen, deren Wohnung in Eigentum verwandelt wird. Warum sich zwischen dem jungen Mann und der älteren Frau eine sporadische, nicht sonderlich leidenschaftliche Affäre entwickelt? Es geschieht bei Bußmann eher, als dass es sich entwickelt.
Womöglich besteht in der Einsicht, dass das Leben einem mehr widerfährt, als dass man es selbst gestaltet, die Haupterkenntnis dieses Romans. So wie es auch Katja ergeht, als sie nachvollziehen will, warum sie sich in Milan verliebt hat: "Sie versuchte sich den Anfang in Erinnerung zu rufen. Wie es sich herangeschoben hatte, hartnäckig, unauffällig, sie hatte als Letzte gemerkt, dass sie verliebt war."
Dass auch dem Roman selbst die Geschehnisse zu widerfahren scheinen, mag seine erzählerische Konsequenz sein. Hierin liegt aber zugleich sein Problem. Was einerseits als eine skrupulöse Autorinnen-Position verstanden werden kann, als ein Sichhineingeben in das Labyrinth der Gegenwart, statt eine trügerische Draufsicht und Souveränität vorzuschützen, verhindert zugleich, dass die Einstellungen an Schärfe gewinnen. Als Befund über komplexe Lebensstrukturen, über die Fallhöhe zwischen allenthalben proklamierter Optimierung auf der einen und diffuser Orientierungslosigkeit auf der anderen Seite mag das durchaus realistisch sein.
Neu ist diese Einsicht allerdings nicht, sie begleitet die urbane Erzählung seit jeher. Leider lässt Nina Bußmann die Frage offen, warum man jenseits der unscharfen Momentaufnahmen, die "Dickicht" versammelt, den Rissen in den Biographien dieser Großstadtbewohner besondere Aufmerksamkeit schenken sollte. Und wo es Bußmann von Zeit zu Zeit gelingt, dieses Interesse zu wecken, da gerät es recht bald wieder im Dickicht aus dem Blick.
WIEBKE POROMBKA
Nina Bußmann:
"Dickicht". Roman.
Suhrkamp Verlag,
Berlin 2020. 317 S., geb., 24,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main