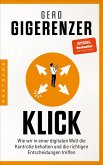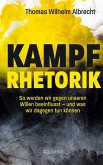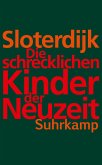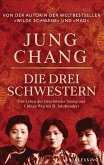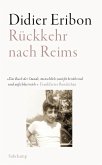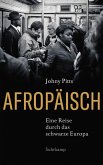Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Oliver Nachtwey deutet uns als eine polarisierte Gesellschaft, die wirtschaftlich im Abstieg und demokratisch im Aufbruch begriffen ist. Ein irritierend deutsches Buch.
Ob wir Deutsche nun, nach Jahrzehnten des "Wohlstands für alle", in der "Abstiegsgesellschaft" leben? Auch nach der Lektüre von Oliver Nachtweys anregendem langen Essay weiß man es nicht so recht. Zwar liefert das Buch zahlreiche Anhaltspunkte dafür, dass dem so sei: die Erosion des Normalarbeitsverhältnisses, der Rückbau sozialstaatlicher Sicherungen, das Anwachsen des Prekariats und das Schrumpfen der Mittelschicht - all das spricht dafür, dass sich die Zeichen der Zeit verändert haben, die Zeiten der Aufstiegsgesellschaft vorbei sind. Doch bietet der Verfasser selbst Argumente genug, um seine Generaldiagnose zu dementieren: Die sogenannten Normalbeschäftigten sind einstweilen "nominal majoritär", weiterhin bestehen "große Zonen der sozialen Stabilität" - und normativ ist der soziale Aufstieg durchaus lebendig, er bleibt "Sehnsuchtsobjekt, Handlungsnorm, politisches Leitbild". Also doch alles beim Alten?
Wohl kaum - auch wenn man den Wandel der gesellschaftlichen Verhältnisse anders deuten und auf einen anderen begrifflichen Nenner bringen mag. Nachtwey zeichnet das Bild einer polarisierten, entlang "neuer Klassenstrukturierungen" gespaltenen Gesellschaft, für die eher das aus der alten Bundesrepublik bekannte Etikett der "Zweidrittelgesellschaft" passend erscheint als die suggestive Formel vom kollektiven sozialen Abstieg. Eine Diagnose, die zudem Plausibilität nur gewinnt im Lichte eines plakativen Gegenbilds von Deutschland, wie es vor Wiedervereinigung, Finanzkrise und Gerhard Schröder gewesen sei: eine "Gesellschaft der Gleichgestellten", in der für breite Mehrheiten "Sicherheit, Status, Prestige" gewährleistet waren.
Auch wenn Nachtwey stets betont, dass es so nicht gemeint ist: Letztlich bietet sich dem Leser doch das recht manichäisch anmutende Panorama eines glücklicheren Gestern, das einer traurigen Gegenwart des sozialen Rückschritts, der demokratischen Regression, ja der gesellschaftlichen "Dekadenz" gewichen ist.
Wo fing das an und wann? Selbstverständlich optiert Nachtwey nicht für eine eindimensionale Erklärung des Aufstiegs der "Abstiegsgesellschaft". Wohl aber hat er einen heißen Kandidaten für den politisch-ökonomischen Siegeszug des die Errungenschaften der "sozialen Moderne" schleifenden Neoliberalismus: Schuld war nicht der Bossanova, ganz entscheidend mit von der Partie aber die "Künstlerkritik". Mit diesem Begriff wird häufig das mit "1968" beziehungsweise "den 68ern" in die Welt gekommene gesellschaftliche Autonomiebegehren belegt, das der bis dahin herrschenden "Sozialkritik" am Kapitalismus den Rang abgelaufen und die Spitze genommen habe.
Seither stünden nicht mehr Fragen materieller Ungleichheit und der Ausbeutung in der Lohnarbeit, sondern solche der kulturellen Identität und entfremdeter Lebensführung im Mittelpunkt der Kapitalismuskritik - ein Kritikmodus, der in idealer Weise anschlussfähig gewesen sei für neoliberale Selbstbestimmungs-, Individualitäts- und Flexibilitätsversprechen. Auch Nachtwey schließt sich diesem - nach wie vor auf dünner empirischer Basis aufruhenden - Deutungsmuster an, wenn er den Postmaterialismus der neuen sozialen Bewegungen als Quelle "neoliberaler Komplizenschaft" und "Ressource der Demontage der gesamten sozialen Moderne" identifiziert.
Nun mag es in der Vergangenheit soziale Akteure mit politischer Diskursmacht gegeben haben, die sich postmaterielle Werte auf die Fahnen schrieben. Die gesellschaftsstrukturierende Kraft eines vermeintlich herrschenden "Post-Materialismus" wird jedoch weithin überschätzt. Für große gesellschaftliche Mehrheiten stand auch nach "68" die beständige Steigerung des Wohlstands, der Konsumchancen, einer im Materiellen verankerten "Lebensqualität" im Zentrum ihres Begehrens. Ein bisschen Postmaterialismus konnte man sich dabei leisten - solange es auch so wirtschaftlich bergauf ging.
Es war der anscheinend unstillbare, zu keiner Zeit der jüngeren Geschichte versiegende Wunsch nach Mehr, aus dem sich die von Nachtwey zu Recht konstatierte "Komplizenschaft mit dem Markt" und "marktbereitender Staatlichkeit" speiste. Denn dass eben dieses Mehrprodukt sich auf Dauer nur mit marktliberalen "Reformen" würde erwirtschaften lassen, war die zentrale Botschaft neoliberaler Politik in Deutschland wie im Rest der Welt. Nicht die Moral (Autonomie), das Fressen (Wachstum) war das As im Ärmel des Neoliberalismus. Und es sticht bis heute.
Apropos Rest der Welt: Er spielt in Oliver Nachtweys Analyse leider so gut wie keine Rolle. Weder als Geburtshelfer des deutschen Nachkriegsaufstiegs noch als Sündenbock eines heute wahrgenommenen Abstiegs. Eingangs war von "uns Deutschen" die Rede, und dies mit Bedacht: "Die Abstiegsgesellschaft" ist ein auf irritierende Weise deutsches Buch.
Die Bedeutung migrantischer Milieus für die Bundesrepublik kommt (außer in der Wendung, dass sie sich "selten als ,Avantgarde des Proletariats' gezeigt" hätten) nicht vor, die "Flüchtlingskrise" als Katalysator der jüngeren deutschen Protestdynamik erst ganz am Ende. Jedoch keine Asylgesetzgebung oder brennenden Flüchtlingsheime, kein institutionalisierter Rassismus und praktisch keine Islamhetze. Für den Autor steht die jüngste "Renaissance des Aufbegehrens" unter demokratisch-sozialen Vorzeichen, dessen "politische DNA" sei progressiv. Doch neue Dienstleistungsstreiks hin, "Blockupy" her: Im Deutschland der Gegenwart ist leider - wiewohl aus sozioökonomisch nachvollziehbaren Gründen - nicht der "Aufruhr der Ausgebildeten" wie etwa im krisengeschüttelten Spanien an der Tagesordnung. Was hierzulande tobt, ist der Aufstand der Eingebildeten: Der lautstarke und politisch folgenreiche Protest derer, die sich einbilden, es könnte und müsste immer so weitergehen mit der nationalen Aufstiegsgesellschaft - und an "unserem" imaginierten Abstieg seien die bösen Anderen schuld.
Oliver Nachtwey hofft, "dass das Aufbegehren nicht irgendwann selbst regressiv wird". Jedenfalls was diesen Wunsch angeht, ist die "regressive Moderne" bereits über sein Buch hinweggegangen.
STEPHAN LESSENICH
Oliver Nachtwey: "Die Abstiegsgesellschaft". Über das Aufbegehren in der regressiven Moderne.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2016.
264 S., br., 18,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main