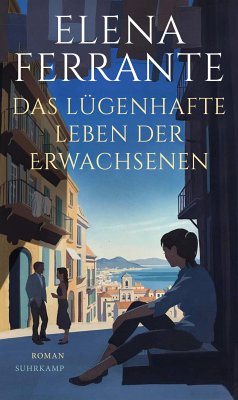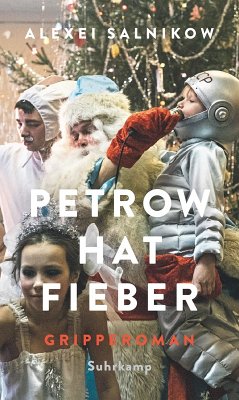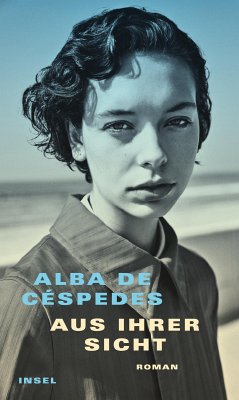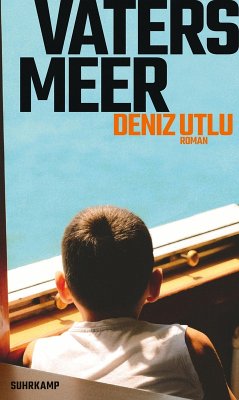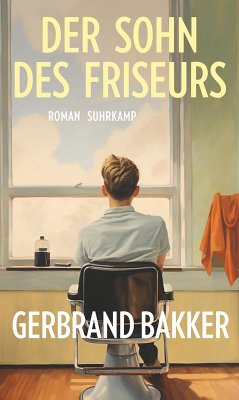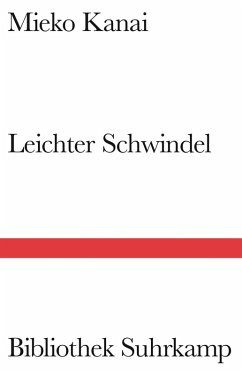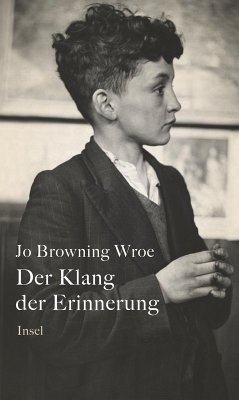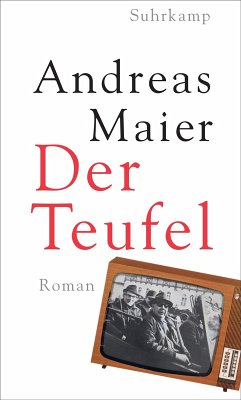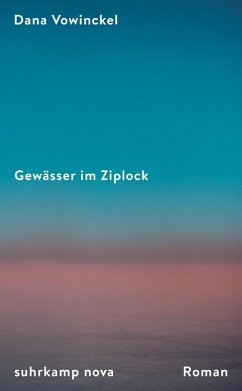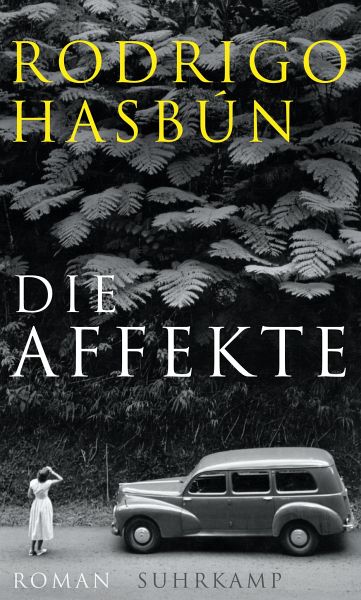
Die Affekte (eBook, ePUB)
Roman
Sofort per Download lieferbar
Statt: 20,00 €**
16,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
>Leibphotograph
>Leibphotograph<. Doch auch das neue Leben ist reich an Spannungen, und für seine nächste Expedition, die Suche nach der verlorenen Inkastadt Paititi, muss die ganze Familie einen hohen Preis zahlen. Insbesondere Monika, die älteste Tochter und ihrem Vater frappierend ähnlich, scheint jeden Halt zu verlieren. Was als persönliche Sinnkrise beginnt, wird zu ihrer politischen Radikalisierung führen und sie zu immer extremeren Maßnahmen treiben.
Rodrigo Hasbún hat eine spektakuläre historische Episode zu einem hochexplosiven Kammerspiel verdichtet. Er erzählt von den Hoffnungen und Ernüchterungen einer deutschen Familie im südamerikanischen Exil und von den unentrinnbaren Fliehkräften der Geschichte.
Rodrigo Hasbún hat eine spektakuläre historische Episode zu einem hochexplosiven Kammerspiel verdichtet. Er erzählt von den Hoffnungen und Ernüchterungen einer deutschen Familie im südamerikanischen Exil und von den unentrinnbaren Fliehkräften der Geschichte.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.