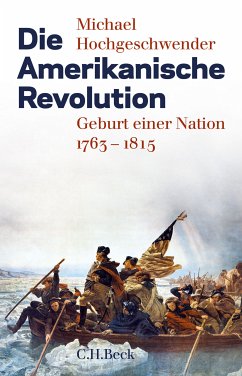Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Michael Hochgeschwender deutet die Amerikanische Revolution und zeigt, wie sie bis in die Gegenwart fortwirkt
Die Amerikanische Revolution steht im europäischen Geschichtsbewusstsein traditionell im Schatten der Französischen. Während in Frankreich gekrönte Häupter rollten und das "unreine Blut" der Tyrannen in Strömen floss, fehlten in Nordamerika der "totalitäre Blutrausch, der genozidale Gewaltexzess, der die Französische Revolution beim Versuch begleitete, einen Neuen Menschen zu generieren", wie der Münchner Kulturhistoriker Michael Hochgeschwender in seiner neuen großen Darstellung der Amerikanischen Revolution schreibt.
Lange Zeit hat die Geschichtsschreibung den Geschehnissen in Nordamerika daher den genuin revolutionären Charakter abgesprochen. Auch Hochgeschwender spricht von einer konservativen Revolution, weil die amerikanischen Kolonisten für den "Erhalt überkommener Privilegien und Freiheiten" gekämpft hätten. Der Freiheitsbegriff, den die amerikanischen Revolutionäre dem Versuch von Krone und Parlament entgegensetzten, die Kolonien an den Lasten des Empires angemessen zu beteiligen, war zutiefst vormodern. Der Autor betont die Bedeutung des Tugendrepublikanismus, des evangelikalen Enthusiasmus und der traditionellen Rechte freier Briten als ideologische Wurzeln der Amerikanischen Revolution, denen gegenüber der Einfluss des liberalen vertragstheoretischen Denkens John Lockes nicht überschätzt werden dürfe: "Die USA waren und sind kein Kind der Aufklärung, sie sind ein Kind des Kompromisses zwischen Vormoderne und Moderne", so Hochgeschwenders pointiertes Diktum.
Dies alles bedeutet nun aber nicht, dass die Amerikanische Revolution gar nicht revolutionär gewesen wäre, und zwar nicht nur, weil Hochgeschwender dann doch ausführlich schildert, wie brutal der Bürgerkrieg zwischen revolutionären Whigs und königstreuen Tories geführt wurde, vor allem wenn sich die Kampfhandlungen mit dem Ziel verbanden, die meist auf Seiten der Briten kämpfenden Indianerstämme zu vertreiben und zu dezimieren. Der anfänglich begrenzte Konflikt um die Besteuerung der Kolonisten entfaltete eine Eigendynamik, die schließlich zum gewaltsamen Umsturz und zur Entstehung einer neuen republikanischen Ordnung führte, aus der sich schließlich eine moderne kapitalistische Marktgesellschaft und die erste egalitäre Massendemokratie für weiße Männer entwickelte.
Der Autor schreibt die Geschichte dieser Revolution in betonter Abgrenzung vom amerikanischen Geschichtspatriotismus und durchaus mit einigem Verständnis für die britische Position. Der Konflikt verlief zudem nicht nur zwischen Kolonien und Mutterland, zwischen amerikanischen Whigs und Tories, sondern war auch ein latenter Klassenkampf zwischen den kolonialen Eliten, denen es um die Wahrung ihrer Eigentumsinteressen ging, und den rebellischen, nach Anerkennung und Gleichheit strebenden Unterschichten. Den widersprüchlichen und leidvollen Erfahrungen der einfachen Menschen, der Soldaten, der Frauen, der schwarzen Sklaven und der Indianer widmet der Autor jeweils lange Kapitel, auch den oft geschmähten hessischen Söldnern, die auf Seiten der Briten kämpften, lässt er Gerechtigkeit widerfahren und spricht sie vom Vorwurf besonderer Rohheit ebenso frei wie vom Makel militärischen Versagens.
Michael Hochgeschwenders Buch ist die bisher beste deutschsprachige Darstellung der Amerikanischen Revolution. Der Autor verfügt über eine enzyklopädische Kenntnis der amerikanischen Geschichte und Geschichtsschreibung, er führt den Leser ebenso kundig durch das Labyrinth der englischen Parteiungen wie durch die politische Ideenwelt des achtzehnten Jahrhunderts. Der Autor ist ein brillanter Analytiker, der souverän komplexe Zusammenhänge und große Entwicklungslinien skizziert, er schreibt mit beeindruckender begrifflicher Präzision und bisweilen auch mit feiner Ironie.
Und doch fehlt diesem Werk etwas, nämlich die Stimmen der handelnden Zeitgenossen. Auf mehr als vierhundert Seiten bleiben die Quellen fast durchweg stumm. So diskutiert Hochgeschwender ausführlich Thomas Paines berühmte Flugschrift "Common Sense", die schon die Zeitgenossen als "Bibel der amerikanischen Revolution" rühmten, aber die beißende Polemik und der trockene Witz, mit denen Paine die Monarchie überschüttet, bleiben dem Leser verborgen. Nicht einmal die Unabhängigkeitserklärung, wohl einer der berühmtesten und einflussreichsten Texte der Weltgeschichte, erscheint dem Verfasser ein Zitat wert.
Diese Distanz zu den Quellen ist bedauerlich, denn die Wortgewalt, mit der sich die Antagonisten der Revolution gegenseitig traktierten, ist ein ästhetischer Genuss, den ein Historiker seinen Lesern nicht vorenthalten sollte, so wenn der englische Gelehrte Samuel Johnson das Freiheitspathos der Kolonisten mit seiner maliziösen Frage bloßstellte: "Wie kann es sein, dass ausgerechnet Sklaventreiber am lautesten nach Freiheit kläffen?"
War die Amerikanische Revolution wirklich die Geburt einer Nation? Man darf vermuten, dass der Verlag sich diesen Untertitel gewünscht hat, denn in seinen Schlussbetrachtungen betont der Autor gerade das unvollendete und widersprüchliche Erbe der Revolution für die weitere Geschichte der Vereinigten Staaten. Von einer einheitlichen, gar geeinten Nation konnte keine Rede sein, Sklaverei und Westexpansion schufen eine schwelende Konfliktlage, die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts in das "Stahlbad des Bürgerkrieges" mündete. Das alles ist, wie Michael Hochgeschwender uns eindringlich vor Augen führt, nicht wirklich Vergangenheit, sondern eine die Gegenwart prägende Geschichte.
MANFRED BERG
Michael Hochgeschwender: "Die Amerikanische Revolution". Geburt einer Nation 1763-1815.
C. H. Beck Verlag, München 2016. 512 S., Abb., geb., 29,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Josef Johannes Schmid, sehepunkte, 20. November 2017
"Eine eindrucksvolle und flüssig geschriebene Darstellung (...) vorzüglich und in Kenntnis vor allem der amerikanischen Forschung geschrieben."
Hermann Wellenreuther, H SOZ KULT, 25. April 2017
"Fundierte und spannend geschriebene Monografie (...) lesenswert."
Alexander Weinlein, Das Parlament, 19. Dezember 2016
"Die bisher beste deutschsprachige Darstellung der Amerikanischen Revolution (...) Der Autor ist ein brillanter Analytiker, der souverän komplexe Zusammenhänge und große Entwicklungslinien skizziert."
Manfred Berg, FAZ, 12. November 2016
"Ein fundiertes Werk, das ein breites Verständnis für Vergangenheit und Gegenwart der USA erlaubt."
Moritz Holler, SWR2 Die Buchkritik, 8. November 2016
"Brillantes (...) spannendes Buch."
Hannes Stein, Literarische WELT, 22. Oktober 2016
"Wer an dieser spannenden Zeit in der amerikanischen Geschichte interessiert ist, liegt mit der Wahl des Buches richtig."
Martin Kessler, Rheinische Post, 12. Oktober 2016
"Eine erfrischende Art des wissenschaftlichen Schreibens."
Tom Goeller, Deutschlandfunk, 10. Oktober 2016
"(A)uf dem neuesten Stand der Forschung."
Neues Deutschland, 18. Oktober 2016
"Eindrucksvoll."
Julian Weber, taz - die tageszeitung, 18. Oktober 2016