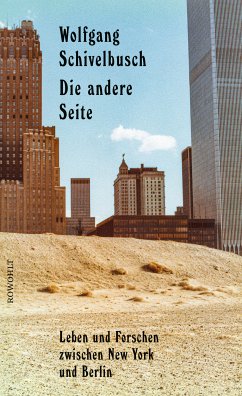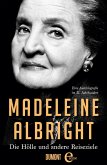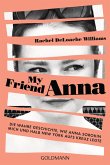Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Reaktionär ehrenhalber: Wolfgang Schivelbusch lässt sich zu seiner intellektuellen Biographie befragen
Lange Jahre führte Wolfgang Schivelbusch so etwas wie die bekannteste Pendlerexistenz im deutschsprachigen Wissenschafts- und Sachbuchbetrieb. Wenige Rezensionen seiner Bücher verzichteten auf den Hinweis, dass der Autor sein Leben zwischen Berlin und New York aufteile. Gute vierzig Jahre lang ging das so, seit er 1973 den Mietvertrag für seine erste eigene Wohnung in New York unterschrieb. Die Stadt, so sagt er selbst, war als "der Punkt, an dem Europa endete und Amerika begann" die für ihn richtige "strategische Position". Fortan verbrachte er dort das Winterhalbjahr und tauchte ab in Bibliotheken mit einer Materialfülle, wie er sie in Deutschland nicht kannte.
Aus ihren unerschöpflich scheinenden Beständen hob er, was ihn zu einem der produktivsten und anregendsten Vertreter der neueren Kulturgeschichte werden ließ. Die "Geschichte der Eisenbahnreise" oder die "Geschichte der künstlichen Helligkeit" zeichneten nach, wie die "Industrialisierung des Menschen" bis in seine alltäglichen Erfahrungen und Wahrnehmungen eindrang. Bevor allerdings, wie er selbst sagt, diese Art der Materialgeschichte zu einer "Masche" werden konnte, wandte er sich von den Dingen ab und dem Geist zu. Fast sprichwörtlich geworden ist aus dieser Zeit die "Intellektuellendämmerung", so der Titel seiner Geschichte der Frankfurter Intelligenz der Zwanzigerjahre. Anfang der Zweitausenderjahre folgten schließlich die großen vergleichenden Studien: "Kultur der Niederlage", die in den Blick nimmt, wie in Frankreich, Deutschland und dem amerikanischen Süden Mythen zur Bewältigung von Kriegsniederlagen reaktiviert werden, und "Entfernte Verwandtschaft", die Ähnlichkeiten zwischen New Deal, Faschismus und Nationalsozialismus nachspürt.
Über seine intellektuelle Existenz zwischen zwei Städten und Kontinenten erzählt Schivelbusch nun in "Die andere Seite". Nach einem schmalen Essayband über den "Rückzug" ist dies seit mehreren Jahren sein erstes Buch, ein vom Verlag eigentümlicherweise nicht als solcher angekündigter Gesprächsband. Wie Schivelbusch im Vorwort unumwunden preisgibt, plagt ihn seit geraumer Zeit eine Schreibblockade. So fungieren also drei verschiedene Gesprächspartner als Geburtshelfer und lenken die Darstellung, wobei die einzelnen Bücher als Wegmarken fungieren. Überlegungen zu deren intellektuellen Voraussetzungen wechseln dabei in lockerer und manchmal assoziativer Folge ab mit Ausblicken auf die historischen und kulturellen Zeitumstände.
Dabei beschreibt der Kulturwissenschaftler nichts, ohne es zugleich mit dem Assoziationsreichtum eines ganzen Leserlebens zu reflektieren, seien es seine eigenen Lebensentscheidungen, seien es Beobachtungen der kleinen Dinge oder der großen Zusammenhänge. Und er gibt Einblicke in ein akademisches Grenzgängertum, das bei der Literaturwissenschaft, bei Peter Szondi, seinen Ausgang nahm, bei dem er die komparatistische Methode des Vergleichens aufgriff, und über Norbert Elias, der ihm den Weg in die Welt der Dinge eröffnete, weiterführte. Dass das Abweichen von den akademischen Fächerzuordnungen auch bedeutete, sich außerhalb der akademischen Karrierewege und damit gesicherter Finanzierung zu bewegen, formuliert Schivelbusch in aller Offenheit.
Das Spiegelverhältnis zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten ist die Achse, an der entlang sich das gesamte Buch orientiert. Trotz aller desillusionierten Analysen der amerikanischen Geschichte der vergangenen fünfzig Jahre, die das Buch durchziehen, markieren die Vereinigten Staaten schon am Anfang einen verheißungsvollen Horizont. Denn Frankfurt, wohin die Familie Schivelbuschs nach dem Ende des Kriegs geflohen war, lag in der amerikanischen Besatzungszone, und staunend bewundert das Kind im Schwimmbad die GIs, die mit der spielerischen Art, sich zu bewegen, ein Gegenbild gegen das schwerfällige und spießige Deutschland verkörpern.
Später entdeckt der frisch Promovierte und den akademischen Beschränkungen Entkommene das kulturelle Schlaraffenland der amerikanischen Massenkultur, die er als Befreiung von den Zwängen der Hochkultur erlebt. Schivelbusch stellt überraschende und erhellende Verbindungen her, wenn er etwa das Leben in den Vereinigten Staaten, die Apotheose des Individualismus, als "Inkarnation der Massenhaftigkeit" schildert. Andere intellektuelle Brückenschläge wiederum geben eher Fragen auf, etwa die These, der Mangel an Arbeitskräften, das Fehlen einer Unterschicht seien in Amerika für die forcierte Entwicklung der Technik ausschlaggebend gewesen. Da wurden offenbar sowohl die von Sklaven getragene Plantagenwirtschaft in den Südstaaten wie auch die Tatsache, dass die spätere Industrialisierung nur unter der Voraussetzung massenhafter Arbeitskraft möglich war, der scharfen Pointe geopfert.
"Die andere Seite" ist ein in vieler Hinsicht nostalgisches Buch, allerdings weniger in dem Sinne, dass sich darin durchweg eine Sehnsucht nach guten alten Zeiten Bahn brechen würde. Manchmal ist das schlichte Gegenteil der Fall, zumindest wenn es Schivelbusch um seine persönliche Geschichte geht. Da empfindet er den Wandel seiner Einstellungen, den Abschied von dem, was er die "guten alten linksliberalen Gewissheiten" nennt, unumwunden als Befreiung. Vielmehr ist "Nostalgie" für Schivelbusch selbst eine analytische Kategorie. Seine Aufmerksamkeit richtet sich auf die alternden Objekte der Massenproduktion, dem, was einst als bahnbrechende neue Technik gefeiert und dann zurückgelassen wurde. Eine Perspektive, wie sie schon seine Geschichte der Eisenbahn bestimmte. Fortschritt und Modernisierung als Verlusterfahrung gegenüber der "größeren Schönheit, Authentizität und Würde des Vergangenen" zu beschreiben, formuliert er als die wichtigste Lehre, die er aus der Lektüre konservativer Autoren gezogen hat. Den Titel Reaktionär würde er durchaus akzeptieren, "honoris causa".
In New York schließlich empfand Schivelbusch seit längerer Zeit "Sättigung, Erschöpfung und Überdruss". Die Stadt wurde immer mehr kommerzialisiert, die "Touristifizierung" verleidete ihm seine Spaziergänge auf der Promenade am Battery Park. Die zunehmende Digitalisierung ließ schließlich auch noch die Bücher in ihrer materiellen Gestalt aus seinen bevorzugten Bibliotheken verschwinden, was Schivelbusch mit besonderer Abneigung verfolgt. 2014 zog er sich aus der "Gewinner-Zwickmühle" wieder ganz nach Berlin zurück, wo er heute seinen achtzigsten Geburtstag begeht. SONJA ASAL
Wolfgang Schivelbusch: "Die andere Seite". Leben und Forschen zwischen New York und Berlin.
Rowohlt Verlag, Hamburg 2021. 336 S., geb., 26,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
© Perlentaucher Medien GmbH
am Menschen
Der Kulturhistoriker Wolfgang Schivelbusch wird 80
Kaum hatten die Eisenbahnen in Großbritannien Mitte des 19. Jahrhunderts ihren Siegeszug angetreten, da warnten Mediziner vor den Gesundheitsgefahren des Schienentransports. Mehr noch als den Unterdruck während der Fahrt fürchteten sie die Vibrationen, die zur Erschütterung und Zerrüttung der Passagiere und ihrer Nerven führten. Um die Härte der mechanischen Schläge zu dämpfen, verlegten sich Bahndesigner und Innendekorateure auf die Produktion von Schonern, Überzügen, Etuis und Polsterungen, die bald bis in die Wohnungen reichten. Auch der zermürbende Blick aus dem Abteilfenster auf die vorrüberfliegenden Landschaften verlangte nach Reizschutz. Das beschrieb Freud später als Rinden-Bildung auf der Oberfläche des Bewusstseins, um den Aufprall der Sinneseindrücke zu mildern. Derweil reagierten die Bahnreisenden auf die neuen Zumutungen mit ohnmachtartigen Müdigkeitsanfällen. Nicht zufällig diskutierten Mediziner und Ingenieure zur selben Zeit die industrielle Ermüdung von Menschen und Maschinen, die sie als Hauptgrund für schwere Unfälle und Neurosen sahen.
Als Wolfgang Schivelbusch 1977 sein Epochenbuch „Geschichte der Eisenbahnreise“ über die „Industrialisierung von Raum und Zeit im 19. Jahrhundert“ veröffentlichte, war das Erstaunen in den Geisteswissenschaften groß. Zwar hatte es seit Norbert Elias immer wieder große Dinggeschichten gegeben, die den Prozess der Zivilisation an Nebenphänomenen wie Schnupftüchern oder Essbesteck aufzeigten. Aber eine Kultur- und Technikgeschichte, die die wechselseitige Modellierung von Menschen und Maschinen untersuchte und dabei die schöpferische Vernichtung des vertrauten Alten durch das erbarmungslos Modernere beschrieb, war weithin neu. Im Maschinenraum der industriellen Revolution entdeckte Schivelbuschdie menschlichen Wesenskräfte.
Der gebürtige Berliner, der über das Theater nach Brecht promoviert wurde, war aus der dünnen Luft der Theoriewelt seines Literatur- und Philosophie-Studiums in die Konkretionen der materiellen Kultur geflohen. Mit seinen beiden folgenden Büchern über Genussmittel und künstliche Beleuchtung schuf er eine Material-Trilogie über die Arbeit der Dinge am Menschen, die ganz ohne die Verrätselungen der französischen Techniktheorie Bruno Latours auskam. Schivelbusch ging stets mit Intuition und Empathie, aber ohne methodische Skrupel an seine gigantischen Materialrecherchen. Diesem auktorialen Dokumentaristen mussten sich die Leser vertrauensvoll ausliefern, um reich beschenkt zu werden.
Schivelbusch, der heute 80 Jahre alt wird, bekleidete nie akademische Positionen, sondern finanzierte sein Privatgelehrtentum ausschließlich mit Stipendien, Projektförderungen und auch Unternehmensaufträgen. So liegt auf seinen glänzend geschriebenen Büchern nicht der Mehltau der universitären Beamtenwissenschaft. Und sein jahrzehntelanges Doppelleben zwischen Berlin und in New York lehrte ihn, dass angelsächsische Wissenschaftsbücher nie nur papiergewordene Druckkostenzuschüsse sind, sondern stets auch verkauft werden müssen. In den USA, so Schivelbusch zu seinem Biographen Stephan Speicher im neuen Gesprächsbuch „Die andere Seite“, war er als Nachgeborener der deutschen Schuld unweigerlich sensibilisiert auch für die Schuld-und Scham-Komplexe anderer Länder. Darüber schrieb er 2001 seine groß angelegte „Kultur der Niederlage“, in der er den verlorenen Krieg der Südstaaten, den französischen Revanche-Gedanken nach 1871 und die Dolchstoßlegende 1918 danach untersuchte, welche Narrative, Mythen und Trauerarbeit bei den Besiegten entstanden. Seitdem zieht sich ein Topos durch seine Werke, der auf Reinhard Koselleck und Carl Schmitt zurückgeht: die Unterscheidung von Siegern und Besiegten. Schivelbusch widmet den Verlierern die größte Aufmerksamkeit, weil vor allem eine Macht, die fällt, für den Geist interessant wird. Selbst dem Tabu des militärischen Rückzugs konnte er jüngst eine Ehrenrettung abgewinnen.
Mit seinem Buch „Entfernte Verwandtschaft“ von 2005 über den staatsgläubigen Zeitgeist der Dreißiger im Faschismus, Nationalsozialismus und New Deal machte er sich in den USA viele Feinde. Darin belegte er die gespenstische Gleichzeitigkeit der großen öffentlichen Kriseninvestitionen zur Arbeitsbeschaffung. Die Zusammenschau von Roosevelts Staudämmen der Tennessee Valley Authority, Mussolinis Kultivierung der Pontinischen Sümpfe und Hitlers Reichsautobahn mitsamt ihren propagandistischen Begleitmusiken ließ die Ambivalenz der bis dahin linearen Fortschrittserzählungen aufscheinen.
Abschied von der Dingwelt nahm Schivelbusch 2015 mit seiner Studie „Das verzehrende Leben der Dinge“, in der er Marx‘ Primat der Produktion und des Gebrauchs von Gütern mit deren Verwandlung durch Konsumtion und Verbrauch zusammendenkt. Gegen die Kurzlebigkeit der Massenprodukte erinnert er an das Kreislaufdenken der griechischen Atomisten, die die Dinge physisch beim Wort nahmen und in steter Umformung durch menschliche Verwendung sahen. Doch im modernen Verschleiß-Konsum erkennt Schivelbusch auch etwas Gutes: dass er so viel Aggression und Zerstörungslust bindet, wie zur Aufrechterhaltung des historisch immer noch einzigartigen Friedenszustandes heute erforderlich ist.
MICHAEL MÖNNINGER
Die schöpferische Vernichtung
des vertrauten Alten durch das
erbarmungslos Modernere
Wolfgang Schivelbusch:
Die andere Seite – Leben und Forschen zwischen New York und Berlin. Rowohlt, Hamburg 2021. 336 Seiten, 26 Euro.
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de