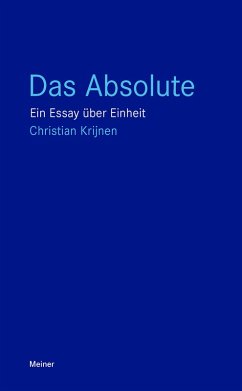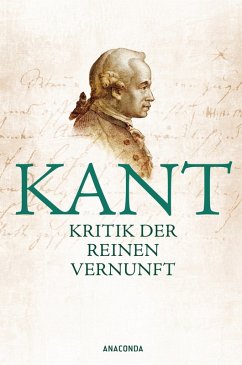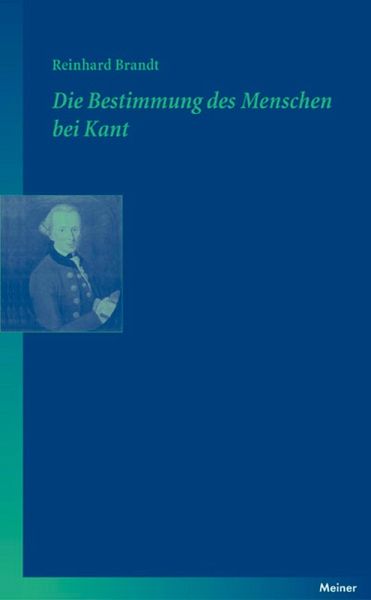
Die Bestimmung des Menschen bei Kant (eBook, ePUB)
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 48,00 €**
35,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Broschiertes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Nach Kant liegt der Zweck der menschlichen Existenz in der Moral und damit der Freiheit, auf sie richtet sich unser gesamtes Vernunftinteresse. Aus diesem gut bezeugten Zentrum werden in der vorliegenden Untersuchung die kopernikanische Wende, die Geschichtsphilosophie und vor allem die drei Kritiken interpretiert; dass die Kritik der reinen Vernunft sich als republikanischer Gerichtshof artikuliert, ist in der Leitidee der moralischen Bestimmung des Menschen begründet. Kants Wirkung beruhte auf dem Freiheitspathos, mit dem er sich gegen die Bevormundung durch die Despoten und eine scholastis...
Nach Kant liegt der Zweck der menschlichen Existenz in der Moral und damit der Freiheit, auf sie richtet sich unser gesamtes Vernunftinteresse. Aus diesem gut bezeugten Zentrum werden in der vorliegenden Untersuchung die kopernikanische Wende, die Geschichtsphilosophie und vor allem die drei Kritiken interpretiert; dass die Kritik der reinen Vernunft sich als republikanischer Gerichtshof artikuliert, ist in der Leitidee der moralischen Bestimmung des Menschen begründet. Kants Wirkung beruhte auf dem Freiheitspathos, mit dem er sich gegen die Bevormundung durch die Despoten und eine scholastisch verwaltete Metaphysik stellte. Im letzten Kapitel, »Die Vierte Kritik«, werden Äußerungen untersucht, gemäß denen eine neue Kritik der reinen Vernunft die drei Kritiken der Vernunft bzw. des Verstandes (1781), der Urteilskraft (1790) und der praktischen Vernunft (1788) in ihrer Vollständigkeit begründen sollte; es wird gezeigt, dass dieses Projekt Kant notwendig schien, aber zugleich nicht durchführbar war.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.