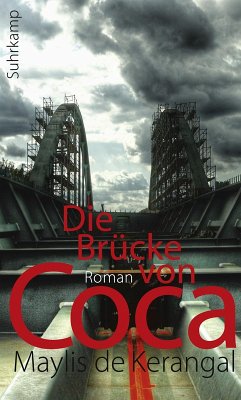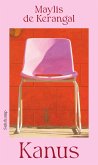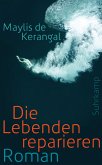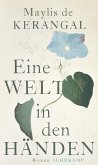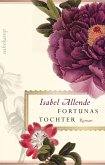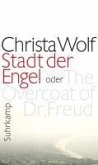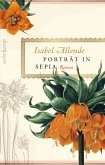Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Maylis de Kerangal schreibt den Roman einer Baustelle und liefert eine Bestandsaufnahme unserer Gegenwart
Fieberhafte Bauwut gestaltet unseren Planeten neu, und der Alte Kontinent sieht tief gespalten zu: In Schwellenländern und Erdölstaaten werkeln europäische Firmen in der ersten Reihe mit, errichten Atomreaktoren, Staudämme, himmelhohe Hotels und tiefe Minen - in der Heimat hingegen glauben die Bürger kaum noch an Megaprojekte; neue Flughäfen, Bahnhöfe oder Kraftwerke werden blockiert. In Frankreich ist man zwar technikaffiner als hierzulande, aber die große historische Bausubstanz und mangelnde Finanzmittel bremsen. Hinzu kommt ein grundsätzlicher Zweifel am Sinn der Betonierung der Welt, eine Zaghaftigkeit, die den ganzen Kontinent befallen hat. Diese Ambivalenz von Projektwahn und kühler Skepsis durchzieht, so seltsam es klingt, auch "Die Brücke von Coca" von Maylis de Kerangal: Es ist der mitreißende Roman einer Baustelle und die überzeugende Bestandsaufnahme unserer Gegenwart.
Am Anfang reckt und streckt sich der drahtige Körper von Georges Diderot. Der Baustellenleiter, ein sportlicher Quartalssäufer, der seit zwanzig Jahren den Planeten umkrempelt, ist die amoralische Triebfeder der Handlung: "Seine Zeit ist die Gegenwart, jetzt oder nie, das Richtige tun, sich der Situation stellen, das ist seine einzige Moral und die einzige Arbeit eines Lebens, so einfach ist das." So gebrochen die Figur, so berauschend ihre Energie: "Immer draußen, konzentriert, empirisch, ungläubig: innere Erfahrung findet niemals innen statt, murmelt er spöttisch" - Diderots Credo ist das des Romans, der im "Sich-Aussetzen", im Nahkampf mit der Welt sein Heil sucht; wie Diderot liebt Kerangal das "technische Epos". Diderots Auftraggeber ist John Johnson, korrupter Bürgermeister des fiktiven Coca, irgendwo an der Pazifikküste der Vereinigten Staaten. Nach einem Dubai-Besuch beschließt er, die Stadt aus ihrem Dornröschenschlaf zu wecken, und kurbelt ein Bauprojekt an: "Eine Brücke, um in den Wald vorzudringen und die fruchtbaren Täler im Südosten des Massivs zu erreichen, eine Brücke, um die Stadt mit der Bay zu verbinden." Das Ganze wird mit einem ökologischen Feigenblättchen verziert, an das in Coca selbst kaum jemand glaubt: Die Stadt ist "rausgeputzt wie eine kleine Nutte", getrieben von Ungeduld und Gier - der Wilde Westen, Version 2010.
Um die zwei Macher herum entwirft Kerangal einen faszinierenden menschlichen Kosmos: von der Betonmischerin Summer bis zum chinesischen Wanderarbeiter Mo Yun, vom Kranführer Sancho bis zur Hilfsarbeiterin Katherine Thoreau, mittendrin der Mörder Soren Cry - es finden sich alle Berufssparten, alle sozialen Schichten, alle Hautfarben. Die Figuren gruppieren sich um Diderot, doch so verwirrend die Vielfalt ist: Kerangal braucht sie, um die Baustelle, um die globalisierte Arbeitswelt zu schildern - beide sind extrem komplex. Sie wählt die exemplarische Methode: Aus jedem Bereich skizziert Kerangal eine Figur oder eine emblematische Szene, von der Planung bis zum Bau, vom Handlanger bis zum Ingenieur. Das Modell ist seit Balzac Standard realistischen Schreibens; hier wird es extrem verdichtet und verknappt. Das - spürbare - Risiko ist, dass die Figuren wie auf dem Reißbrett entworfene Konstrukte wirken. Wie Zola versucht Kerangal ihm durch eine mitreißende Schilderung zu begegnen: Insofern ist der mächtige Strom, über den die Brücke gebaut wird, eine "lange goldene Kobra, schlummernd und wild", die geheime Seele, ja das Vorbild des Romans, der ein "roman fleuve", ein "Flussroman", im konkreten und dynamischen Sinn des Wortes sein möchte (nicht wie herkömmlich ein mehrbändiges, episches Erzählwerk). Meist gelingt Kerangal das Wagnis, und man wünscht sich, weitere Romane der 1967 geborenen Französin zu entdecken.
Eine titanische Leistung lässt das Projekt Wirklichkeit werden. Durch 800 Arbeiter wird eine Fläche von 25 Quadratkilometern "zementiert, betoniert, glattgewalzt", werden zwei riesige Stahlpfeiler gepflanzt, wird eine 25 000-Tonnen-Fahrbahnplatte verbaut. Der Bau übersteht Vogelzüge, Proteste von Umweltschützern und Indianervertretern, Arbeitsunfälle, einen Streik und den Anschlag der Mafia. Am Ende des Romans steht nicht nur die Brücke, sondern auch das jenseitige Ufer, zu dem sie führt. Der Leser entdeckt es mit Diderot und Summer, die Ausflüge in den Urwald unternehmen - Diderot scheint von seinem Namensvetter, dem Aufklärer, mit der materialistischen Haltung die Begeisterung für die Neue Welt übernommen zu haben.
Der Roman klingt aus in einer hybriden Idylle, im dichten Laub, das Müll, Kriminelle und Gutmenschen aufnimmt. Der Leser blickt aus dieser bedrohten Welt, deren Einwohner den Widerstand organisieren, auf das Megaprojekt zurück und fragt sich mit einem Hauch von Enttäuschung, ob es die Mühe wert war - fiebernde Energie weicht träger Skepsis. Zuletzt treiben Diderot und Katherine im Fluss "und gleiten davon wie Indianer". Der Roman wirkt unentschieden: Kommt hier der Fortschritt an sein Ende, zwischen Dschungelgrün und einer fortgeworfenen Sandalette? Oder ist das die Ruhe vor dem nächsten Projekt? Diese Frage, Europas Frage, lässt Kerangal offen.
NIKLAS BENDER
Maylis de Kerangal: "Die Brücke von Coca". Roman.
Aus dem Französischen von Andrea Spingler. Suhrkamp Verlag, Berlin 2012. 288 S., geb., 19,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main