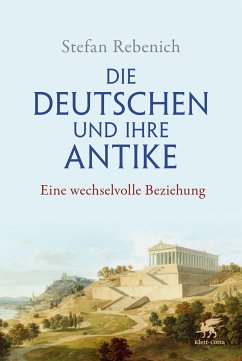Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur Dlf Kultur-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Selbstvergewisserungen im Blick zurück: Stefan Rebenich zeichnet deutsche Beschäftigungen mit der Antike nach
Vor bald dreißig Jahren legte der Neuzeithistoriker Hagen Schulze in einem noch immer lesenswerten Aufsatz dar, warum im Laufe der europäischen Geschichte wiederholt auf die Antike zurückgegriffen wurde und es zu Renaissancen kam, in denen ein antikes 'Erbe' konstruiert, rezipiert und transformiert wurde. Diese Wiedererweckungen boten den Europäern auf dem Weg in die verstörende Moderne Anker, um "dem Ansturm des gänzlich Neuen zu widerstehen, den Standort des Ich wie des Anderen zu bestimmen und die Erscheinungen zu kategorisieren".
Der Anker bestand in einem Bezugssystem von Namen, Ereignissen, Ideen, Formen, Symbolen und Zitaten, die neben der biblischen Welt über lange Zeit gesicherter Bestandteil des europäischen Wissenskanons waren. Doch allein als Zuflucht vor dem alles durchgärenden Wandel hätten die Alten kaum ein so mächtiges zweites Leben erlangen können. Schulze sah im Haupterbe der Antike, dem Vertrauen auf die menschliche Fähigkeit zur Vernunft, einen Impuls zur steten Weiterentwicklung, die möglich war, weil sie sich in den vertrauten Begriffen, Denkformen und Grundsätzen der antiken Überlieferung bewegte, doch gleichwohl über diese hinaus neue Pfade und Ziele suchte.
Im Rahmen dieses übergreifenden Prozesses ist der Weg der Deutschen zu sich selbst auf dem Umweg über die Alten oft behandelt worden. Sätze wie Mephistos "Es ist ein altes Buch zu blättern: Vom Harz bis Hellas immer Vettern!" wurden zu goldenen Worten, und nach dem Zweiten Weltkrieg variierte E. M. Butler die These von einem fatalen deutschen Sonderweg in dem plakativen Buchtitel "The Tyranny of Greece over Germany". In aktuellen Debatten um die Zukunft der Demokratie kommen expertokratische Modelle à la Platon ebenso auf den Tisch wie die Vorteile der Losung von Funktionsträgern, die im klassischen Athen Kernbestand demokratischer Praxis war.
Grund und Anlass genug also, zu differenzieren und die Umstände der wechselvollen Beziehungen der Deutschen zu "ihrer" Antike zu klären. Der Berner Althistoriker Stefan Rebenich hat seit mehr als zwei Jahrzehnten zahlreiche Studien vorgelegt; diese finden sich nun in stark überarbeiteter Gestalt und ergänzt durch gänzlich neu verfasste Kapitel zu einem filigran komponierten Buch vereint. Der Autor schreibt Wissenschaftsgeschichte auf der Höhe der Zeit, mit Blick zugleich auf leitende Ideen, formative Institutionen, wegweisende Individuen und markante Inhalte. Ausgeklammert bleibt mit gutem Grund das Riesenfeld der Antike-Rezeption in Literatur, Architektur und Bildender Kunst; auch in dem eindringlichen Stück zum Platonbild im George-Kreis geht es primär um die Bemühungen der gelehrten Adepten des Meisters, in Abgrenzung von der akademischen Klassischen Philologie Sein und Gestalt zu schauen.
Rebenich sucht immer wieder die Archive auf. So erschließt ein besonders lesenswertes Kapitel den Neustart wissenschaftlicher Kommunikation nach dem Zweiten Weltkrieg anhand von "ersten Briefen", in denen die Fachgemeinschaft Exklusion und Inklusion aushandelte. Manch glücklicher Fund vermag aktuelle Moden ironisch zu spiegeln. So wollten 1938 die Leipziger Ordinarien für Alte, Mittelalterliche und Neuere Geschichte - Helmut Berve, Hermann Heimpel und Otto Vossler - hinfort nur noch Professoren der Geschichte heißen, da sich die überkommene Fächerteilung längst als fragwürdig, ja unerträglich erwiesen habe. Forschungsstand und Zeitgeist wiesen vielmehr auf das Ganze, da inzwischen "das Volk als übergreifende Macht in der Geschichte anerkannt und zugleich das räumliche wie das zeitliche geschichtliche Weltbild, insbesondere auch die Vorgeschichte, in einen ganz neuen Rahmen gestellt ist, in dem der landläufige Dreitakt der Geschichte als kleinlich und scholastisch im schlechten Sinne des Wortes erscheinen muss". Angesichts der Wucht gegenwärtiger Umbrüche trete die Einheit der deutschen und damit der Weltgeschichte neu ins Bewusstsein, und "die Entdeckung der Rasse als Geschichtsmacht würde allein schon genügen, die Herkunft des eigenen Seins in einer weltgeschichtlichen Sicht zu sehen". Periodisierungskritik und Globalgeschichte können ihre Tücken haben.
Das Buch spannt den Bogen einer modernen, zugleich kritischen Wissenschaftsgeschichte von 1800 bis in die Gegenwart; dabei sind auch Lücken benannt. So sei die Geschichte der Frauen in den Altertumswissenschaften und überhaupt deren Bedeutung für die Rezeption der klassischen Antike noch zu schreiben. Erst seit den späten Sechzigerjahren des vorigen Jahrhunderts wurden Wissenschaftlerinnen auf Professuren berufen. In den strukturkonservativen Fächern, so stellt der Autor ohne Beschönigung fest, waren universitäre Besetzungsverfahren jahrzehntelang von Männerbünden dominiert und von männlichen Netzwerken kontrolliert. Indem Rebenich Brennweite und Tiefenschärfe variiert, von mauerschauartigen Überblicken bis zu detaillierten Fallstudien, bekommt er die Vielfalt der Befunde in den Griff und vermeidet, in lineare Fortschritts- oder Niedergangerzählungen zu verfallen. In der Tat folgten auf Phasen produktiver wissenschaftlicher Auseinandersetzung immer wieder auch Perioden von Stagnation.
Die Geschichte der Altertumswissenschaften, einer der roten Fäden, ist vor allem deshalb wichtig, weil ihr Gegenstand zugleich einen Hauptinhalt von Bildung darstellte und insofern Teil einer breit angelegten Gesellschaftsgeschichte ist. Mit Recht schildert Rebenich an der Person und den Projekten Wilhelm von Humboldts, wie im Deutschland des frühen neunzehnten Jahrhunderts die Antike als historiographisches Konstrukt und als idealisierte zeitlose Projektion individueller wie kollektiver Wünsche maßgeblich zur kulturellen Homogenisierung des Bürgertums sowie zur Formierung eines bürgerlichen Selbstverständnisses beitrug, wie aber im weiteren Verlauf der Weg in die arbeitsteilige, quasiindustrielle Großforschung im Sinne Theodor Mommsens zwar "die Archive der Vergangenheit zu ordnen" ermöglichte, diese Entwicklung aber spätestens nach 1918 vielen als Sackgasse erschien - auf der Suche nach Sinn und Vorbildern wurde das historistische Paradigma vielfach schroff abgelehnt. Auch für die Zeit nach 1945 ist das Bild nicht eindeutig: Neben Kontinuitätsfiktionen und restaurierte Betriebsamkeit traten neue Perspektiven, oft inspiriert von anderen Disziplinen und Ländern.
Das emanzipatorische Potential einer diverser gewordenen, kritisch erforschten und auf vielen Wegen vermittelten Antike erscheint Rebenich über all die Wendungen hinweg keineswegs erschöpft; im Sinne Humboldts das Eigene am Fremden zu verstehen sei unverändert plausibel, ebenso der Hinweis von Claude Lévi-Strauss, keine Kultur könne sich selbst denken, wenn sie nicht auf andere Gesellschaften blicke, die als Vergleichsmaßstab dienen. Das Studium der Alten Welt, ihrer Sprachen und Kulturen bleibt demnach eine wirkungsvolle Technik der Entfremdung, eine intellektuelle Übung, um die eigene Position in Frage zu stellen. UWE WALTER.
Stefan Rebenich: "Die Deutschen und ihre Antike". Eine wechselvolle Beziehung.
Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2021. 496 S., geb., 38,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main