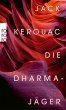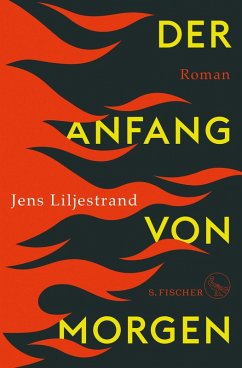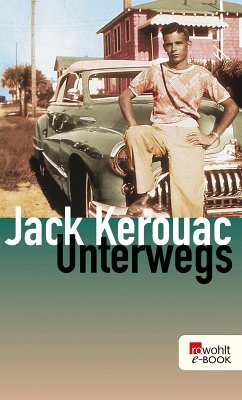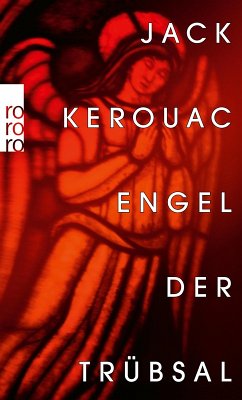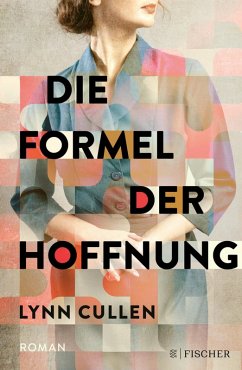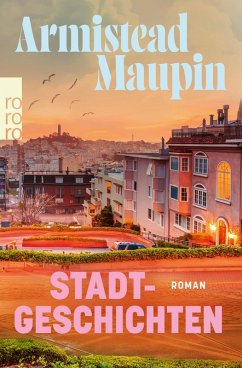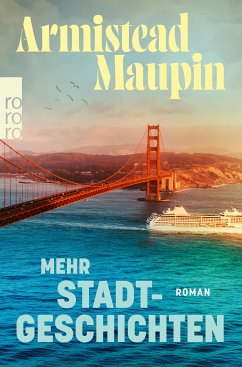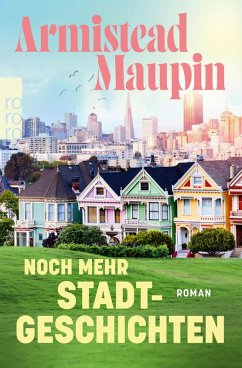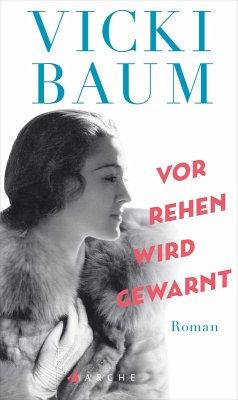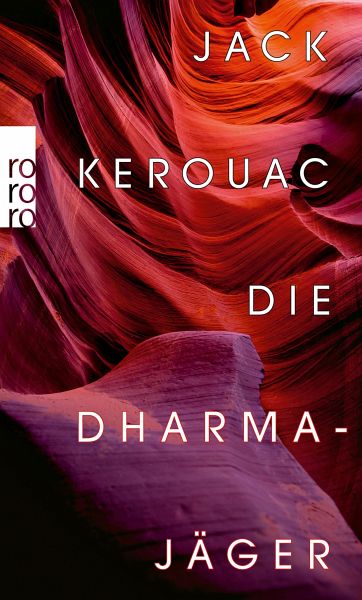
Die Dharmajäger (eBook, ePUB)
Der Klassiker der Beatnik-Generation neu übersetzt
Übersetzer: Überhoff, Thomas
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 24,00 €**
9,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Abenteuerroman, antikonsumistisches Manifest und zugleich «nature writing» at its best. Ein Klassiker der Beat-Literatur, zu Jack Kerouacs hundertstem Geburtstag am 12.3.2022 in neuer Übersetzung. Mal als blinder Passagier auf alten Güterzügen, mal zu Fuß in dünnen Stoffschuhen ist Ray Smith (Kerouac) unterwegs durch Kalifornien - ein wenig ziellos, bis er auf Japhy (Gary Snyder), den Dichterfreund und Zen-Buddhisten, trifft. Gemeinsam mit dem Jodler Morley brechen sie auf in die kaum berührte Natur der High Sierras, um die Lektion der Einsamkeit zu lernen. Sie dichten, sie wandern und...
Abenteuerroman, antikonsumistisches Manifest und zugleich «nature writing» at its best. Ein Klassiker der Beat-Literatur, zu Jack Kerouacs hundertstem Geburtstag am 12.3.2022 in neuer Übersetzung. Mal als blinder Passagier auf alten Güterzügen, mal zu Fuß in dünnen Stoffschuhen ist Ray Smith (Kerouac) unterwegs durch Kalifornien - ein wenig ziellos, bis er auf Japhy (Gary Snyder), den Dichterfreund und Zen-Buddhisten, trifft. Gemeinsam mit dem Jodler Morley brechen sie auf in die kaum berührte Natur der High Sierras, um die Lektion der Einsamkeit zu lernen. Sie dichten, sie wandern und meditieren, immer auf der Jagd nach dem Dharma und einem intensiven, sinnerfüllten Leben. Nur: Im wildromantischen San Francisco mit seinen Hipster-Partys, Poetry-Sessions, Trink-Marathons fällt es schwer, vom Weg der Askese nicht wieder abzukommen ... Jack Kerouac zählt mit Allen Ginsberg und William S. Burroughs zu den führenden Stimmen der Beat Generation, die in den späten Fünfzigern des 20. Jahrhunderts eine der prägendsten subkulturellen Bewegungen der USA begründete. Unter dem damals zeitgemäßen Titel «Gammler, Zen und hohe Berge» in Deutschland berühmt geworden, schließt das im Original «The Dharma Bums» genannte Buch an Kerouacs Welterfolg «On the Road» an.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.