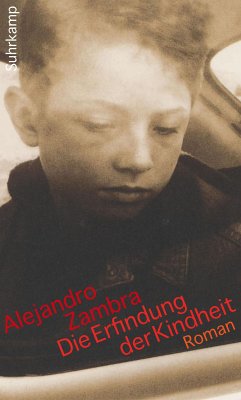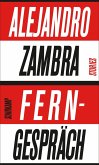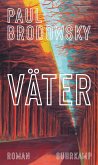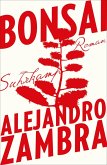Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Erinnern bedeutet Andichten: Der chilenische Romancier Alejandro Zambra hat mit "Die Erfindung der Kindheit" ein Vexiervirtuosenstück geschrieben.
Für einen vorpubertären Jungen gibt es kaum etwas Aufregenderes, als andere auszuspionieren. Das liegt nicht am Willen zur Konspiration, sondern daran, dass Beschattungsarbeit zwei elementar kindliche Veranlagungen befriedigt: Abenteuerlust und Neugier. Dem Heranwachsenden erscheint der Alltag als Einladung zum Wagnis, die Welt, vor allem die der Erwachsenen, als Mysterium, das sich durch gründliche Observation womöglich entschlüsseln lässt.
So sieht es auch der namenlose Protagonist in Alejandro Zambras Roman "Die Erfindung der Kindheit". Er ist neun Jahre alt und wird von der zwölfjährigen Claudia darum gebeten, ihren Onkel Raúl zu überwachen. Was das Mädchen dadurch herauszufinden hofft, erwähnt sie mit keiner Silbe. Trotzdem ist der Auftrag willkommen: Als Abenteuer verspricht er Nervenkitzel, als Rätsel motiviert er zur Suche nach Claudias Absichten, als zu bewahrendes Geheimnis vertieft er die Beziehung zwischen den zwei Eingeweihten. Arglos macht sich der Hobbyspion ans Werk.
Der Leser hingegen ahnt, dass die Mission so unbedenklich nicht sein kann, denn die Geschichte ereignet sich während Pinochets Militärdiktatur in der zu Santiago de Chile gehörenden Kommune Maipú. Von den prekären Verhältnissen um ihn herum merkt der Junge freilich wenig, seine Eltern meiden das Thema. Nur hier und da fallen ihm Merkwürdigkeiten auf, manchmal verunsichern ihn Empfehlungen der Erwachsenen, etwa wenn ihm ein Lehrer rät, niemals über seinen politisch indifferenten Vater zu sprechen. Ebenso unerklärlich ist es ihm, dass er keinen Besuch empfangen darf, was seine Mutter mit dem unzumutbar schmutzigen Zustand des tatsächlich blitzsauberen Hauses rechtfertigt. Man verharrt in Habtachtstellung und misstraut einander.
Bei einer Gelegenheit allerdings, in der Erdbebennacht am 3. März 1985, bilden die Menschen eine solidarische Gruppe. Den Jungen irritiert das, es kommt ihm "seltsam vor, die Nachbarn vielleicht zum ersten Mal versammelt zu sehen". Wie schon in Heinrich von Kleists Erzählung "Das Erdbeben in Chili" ist auch hier die Verwirklichung einer ideologiefreien Gemeinschaft an den durch die Naturkatastrophe herbeigeführten Ausnahmezustand gebunden. Erst höhere Gewalt nivelliert politische Ressentiments. Die Erwachsenen sitzen am Lagerfeuer, trinken Wein, rauchen Zigaretten und tauschen Verschwörerblicke aus. Ihre Kinder hocken in Zelten und entwerfen eine eigene Erklärung des Bebens: "Als Nächstes malten wir uns aus, die Erde wäre ein Hund, der sich schüttelte und die Leute wie Flöhe in den Weltraum schleuderte."
Immer wieder stoßen wir auf solche kindlichen Spekulationen. In dieser Hinsicht ist der Roman der frühromantischen Poetik verpflichtet, die das Herbeiphantasieren alternativer Wirklichkeiten zum ästhetischen Prinzip par excellence erhob. Vor der ersten Beschattungsaktion stellt sich der Junge vor, bald Zeuge filmreifer Szenen zu werden, bei denen "schweigsame Männer mit Sonnenbrillen, die in geheimnisvollen Wagen" vorfahren, folgenschwere Geschäfte abwickeln. Doch nichts dergleichen passiert, fast langweilig geht es zu. Nur einmal scheint sich Nennenswertes zu vollziehen: Der Junge beobachtet, wie Raúl seinen Jeep mit Kisten belädt, um sich aus dem Staub zu machen. Als er Claudia davon berichten möchte, hört er von der Nachbarin, dass sie fortgezogen ist.
Statt an diesem Punkt die Entwirrung des nebulösen Plots zu liefern, dreht Alejandro Zambra lieber beherzt weiter an der Komplexitätsschraube. Wir erfahren, dass das bisherige Geschehen einem Roman entstammt, dessen fiktiver Autor während der chilenischen Militärdiktatur aufwuchs. Damit ist das Spiel vielschichtiger Verflechtungen perfekt: Der 1975 in Chile geborene Zambra erlebte als Kind die Pinochet-Jahre und legt nun einen Roman über einen Schriftsteller vor, der als Kind die Pinochet-Jahre erlebte und einen Roman über jemanden schreibt, der als Kind die Pinochet-Jahre erlebte. Allein diese Konstellation wirft zahlreiche literaturtheoretische Probleme auf. Kann man historische Ereignisse in literarischen Texten guten Gewissens referentiell lesen, oder werden sie qua Ästhetisierung zu autonomen Begebenheiten? Ist es zulässig, vom Leben des Autors auf sein Werk zu schließen? Und worin unterscheiden sich künstlerische und reale Erinnerung?
In einem tagebuchartigen Werkstattbericht beschäftigt sich der erdachte Autor mit derartigen und noch grundlegenderen Schwierigkeiten. Mit seiner Mutter gerät er in einen Disput darüber, ob man sich mit Romanfiguren aus einer anderen Gesellschaftsschicht identifizieren kann oder nicht; der Schwester zählt er jene Familienmitglieder auf, die sich in seinem Text wiederfinden.
Das sind anspruchsvolle, streckenweise gar lehrreiche Intermezzi, die als poetische Selbstreflexionen ebenfalls in der Tradition der Frühromantik stehen. Leider entfalten sie sich auf Kosten des packenden Ausgangsplots, den sie recht brüsk abwürgen. Der Roman hätte von weniger prodesse und mehr delectare durchaus profitiert, die Geschehnisse um den Jungen sind reflektiert genug. Wenn wir das nächste Mal auf ihn treffen, ist aus ihm bereits ein Mann geworden, der sich in einem "ruhigen, achtbaren Leben" übt. Abermals begegnet er Claudia, die endlich das Rätsel um ihren Onkel aufklärt. In langen Unterhaltungen rekonstruieren beide die Vergangenheit, um sie gleichsam zurückzuerobern, um den authentischen Kern der eigenen Geschichte aus der Geschichte der Elterngeneration herauszuschälen. Allerdings ist das kaum möglich, denn Erinnern bedeutet immer auch Andichten. So wird aus der Suche nach der Wahrheit die Erfindung der Kindheit.
KAI SPANKE
Alejandro Zambra: "Die Erfindung der Kindheit". Roman.
Aus dem Spanischen von Susanne Lange. Suhrkamp Verlag, Berlin 2012. 167 S., geb., 18,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main