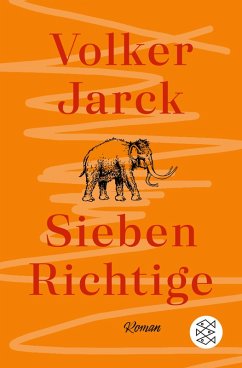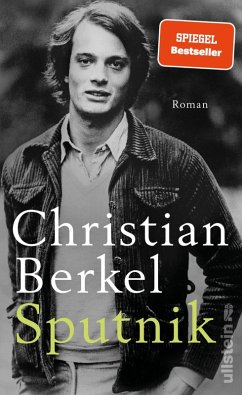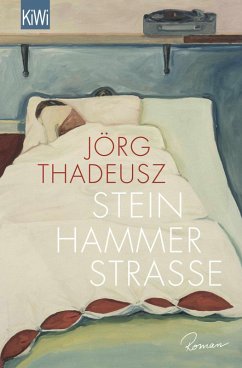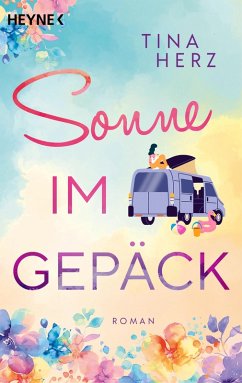Die Geschichte eines einfachen Mannes (eBook, ePUB)
Roman
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 12,00 €**
9,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Broschiertes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Aus dem Leben eines Taugenichts Unser Erzähler ist vom Glück geküsst. Er, der Junge aus einfachem Hause, spürt, dass das Schicksal Großes mit ihm vorhat. Erst als Helmut Kohl 1998 die Wahl verliert, zeigt seine Zuversicht Risse. Wird nun alles schlechter? Nach dem Abitur macht er sich voller Euphorie und dennoch maximal besorgt auf die Reise nach ganz oben. Um ein Haar erlebt er mit seiner Band den großen Erfolg, beginnt beinahe eine steile akademische Karriere, fast findet er das Glück in der Liebe und tänzelt dabei ständig am Abgrund. Doch wenn man ihm glauben will - und nichts wün...
Aus dem Leben eines Taugenichts Unser Erzähler ist vom Glück geküsst. Er, der Junge aus einfachem Hause, spürt, dass das Schicksal Großes mit ihm vorhat. Erst als Helmut Kohl 1998 die Wahl verliert, zeigt seine Zuversicht Risse. Wird nun alles schlechter? Nach dem Abitur macht er sich voller Euphorie und dennoch maximal besorgt auf die Reise nach ganz oben. Um ein Haar erlebt er mit seiner Band den großen Erfolg, beginnt beinahe eine steile akademische Karriere, fast findet er das Glück in der Liebe und tänzelt dabei ständig am Abgrund. Doch wenn man ihm glauben will - und nichts wünscht er sich mehr -, wird am Ende alles gut für ihn. Timon Karl Kaleyta erzählt von einem, der auszieht, um die Welt für sich zu gewinnen. Irisierend, funkelnd, schöner als der schöne Schein! "Pausenlos gelacht und immerzu gelitten - ich kann Timon Karl Kaleyta fühlen." - Christian Ulmen "Timon Karl Kaleyta ist ein so überragend guter Liedtexter - muss der jetzt wirklich auch noch ein Buch schreiben? Ich meine: JA!"- Benjamin von Stuckrad-Barre "Ein erstaunliches Buch! Mit schelmischer Selbstironie und Leichtherzigkeit gelingt Kaleyta eine anmutige Frechheit über unsere Klassengesellschaft." - Samira El Ouassil "So wie Kaleyta davon erzählt, wie es immer nur so gut wie und fast und beinahe und dann doch eben nicht so richtig abging mit seiner Karriere, klingt die Geschichte wie eine exemplarische Universalgeschichte. Man wünscht sich unter jede seiner Wahrheiten einen Beat." - Peter Richter, SZ
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.