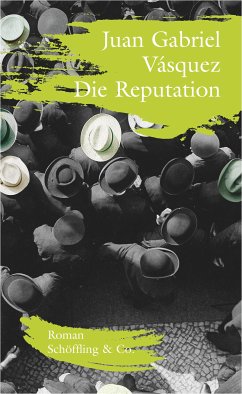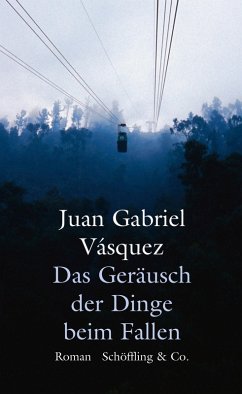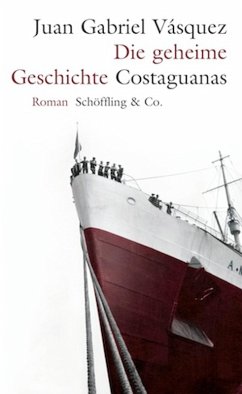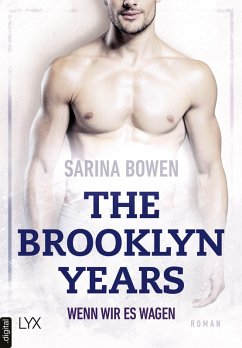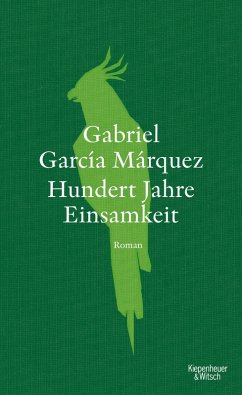Die Gestalt der Ruinen (eBook, ePUB)
Roman
Übersetzer: Lange, Susanne
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 26,00 €**
15,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Kolumbien 1948: Der liberale Politiker Jorge Eliécer Gaitán wird in Bogotá auf offener Straße ermordet. Sein Tod stürzt Kolumbien in die tiefste Krise seiner Geschichte. Jahrzehnte später wird ein Mann verhaftet, als er versucht, den Anzug Gaitáns aus einem Museum zu stehlen. Überzeugt von einer Verschwörung und besessen von der Suche nach der Wahrheit hinter der Ermordung Gaitáns bedrängt er auch den Schriftsteller Juan Gabriel Vásquez. Hängt das Attentat auf Gaitán mit dem auf John F. Kennedy zusammen? Und welche Verbindung gibt es zu den Attentaten auf Erzherzog Ferdinand in S...
Kolumbien 1948: Der liberale Politiker Jorge Eliécer Gaitán wird in Bogotá auf offener Straße ermordet. Sein Tod stürzt Kolumbien in die tiefste Krise seiner Geschichte. Jahrzehnte später wird ein Mann verhaftet, als er versucht, den Anzug Gaitáns aus einem Museum zu stehlen. Überzeugt von einer Verschwörung und besessen von der Suche nach der Wahrheit hinter der Ermordung Gaitáns bedrängt er auch den Schriftsteller Juan Gabriel Vásquez. Hängt das Attentat auf Gaitán mit dem auf John F. Kennedy zusammen? Und welche Verbindung gibt es zu den Attentaten auf Erzherzog Ferdinand in Sarajevo und Rafael Uribe Uribe in Kolumbien?Die Gestalt der Ruinen deckt ein komplexes Geflecht von Anhängern und Gegnern der Demokratie auf und fragt nach dem Spielraum der Literatur zwischen Investigation und Skepsis. In seinem schonungslosen Roman verknüpft Juan Gabriel Vásquez die leidenschaftliche Erforschung all dessen, was unsere Freiheit gefährdet, mit klugen autobiografischen Reflexionen: Geschichte und Politik spiegeln sich im eigenen Leben und Schreiben.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.