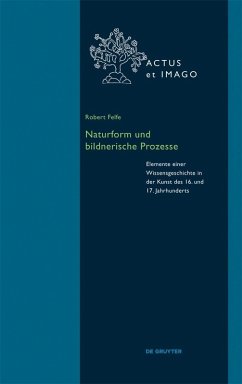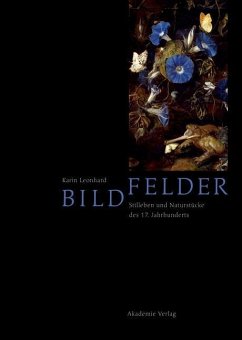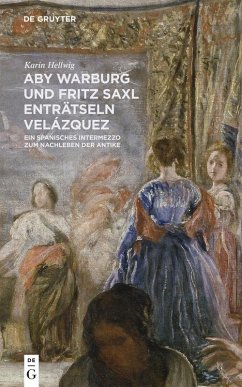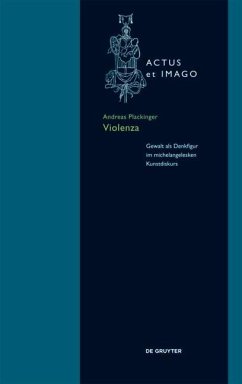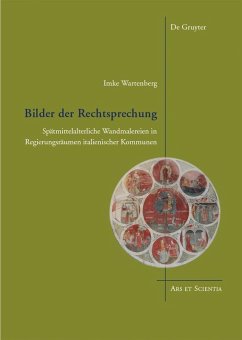Die Gestaltungsprincipien Michelangelos, besonders in ihrem Verhältnis zu denen Raffaels (eBook, PDF)
Aus dem Nachlass
Redaktion: Panofsky, Gerda
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
109,95 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Die wiederentdeckte Habilitation Erwin Panofskys1920 reichte Erwin Panofsky, einer der einflussreichsten Kunsthistoriker des 20. Jahrhunderts, in Hamburg seine Habilitationsschrift zu Michelangelo ein. In den folgenden Jahren arbeitete Panofsky stetig an dem Manuskript weiter, doch veröffentlicht wurde es nie. Seit seiner Emigration 1934 galt es als verschollen. Nach seiner Wiederentdeckung im Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München im Jahr 2012 wurde das Manuskript von Panofskys Witwe, der Kunsthistorikerin Gerda Panofsky, ediert. Die Habilitation Panofskys liegt nun erstmals in g...
Die wiederentdeckte Habilitation Erwin Panofskys
1920 reichte Erwin Panofsky, einer der einflussreichsten Kunsthistoriker des 20. Jahrhunderts, in Hamburg seine Habilitationsschrift zu Michelangelo ein. In den folgenden Jahren arbeitete Panofsky stetig an dem Manuskript weiter, doch veröffentlicht wurde es nie. Seit seiner Emigration 1934 galt es als verschollen. Nach seiner Wiederentdeckung im Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München im Jahr 2012 wurde das Manuskript von Panofskys Witwe, der Kunsthistorikerin Gerda Panofsky, ediert. Die Habilitation Panofskys liegt nun erstmals in gedruckter Fassung vor, ergänzt durch eine Einführung der Herausgeberin und das Faksimile des kompletten, handschriftlich korrigierten und ergänzten Manuskriptes.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.