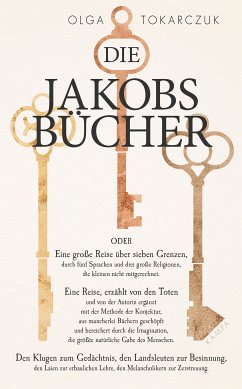Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur Dlf Kultur-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

In ihrem großen Werk "Die Jakobsbücher" rekonstruiert die Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk den kuriosen Lebensweg des Sektenführers Jakob Frank.
Das Interesse sei groß, das Buch aber leider nicht lieferbar: Diese Antwort, die wir vor kurzem in einer führenden Münchner Buchhandlung bekamen, als wir wissen wollten, wie sich der neue Roman der frisch gekürten Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk denn verkaufe, spricht Bände. Denn einerseits ist da diese Autorin, die zwar in Deutschland seit langem keine Unbekannte mehr ist, deren letzte deutsche Veröffentlichung aber ("Der Gesang der Fledermäuse") bereits acht Jahre zurückliegt und die nun als denkbare, doch nicht unbedingt erste Kandidatin für den wichtigsten Literaturpreis der Welt galt.
Und andererseits hat es die polnische Literatur hierzulande nicht leicht. Von der Kritik wird sie meistens wahrgenommen und nicht selten mit Lob bedacht, die Leser aber bleiben oftmals eher zurückhaltend. Verständlich also, dass der kleine Zürcher Kampa Verlag, den es selbst erst seit einem Jahr gibt, Olga Tokarczuks sehr aufwendig gestalteten, fast 1200 Seiten starken Roman offenbar fürs Erste nur in einer kleinen Auflage herausbrachte. Ob er nun aber, nach dem nobelpreisbedingten Nachdruck, auf einen großen Publikumserfolg hoffen darf? Das wagt man zu bezweifeln, auch wenn es ein Buch ist, auf das man gar nicht anders reagieren kann als mit einer tiefen Verbeugung. Ein enormer literarischer Kraftakt, ein enzyklopädisches Werk, das dem Leser entsprechend viel Zeit, Geduld, Konzentration und Wissensdurst abverlangt.
Allein die Frage, wovon diese, wie der Untertitel verspricht, "große Reise über sieben Grenzen, fünf Sprachen und drei große monotheistische Religionen" handelt, ist nicht so schnell und eindeutig zu beantworten, wie es auf den ersten Blick scheint. Vordergründig folgt sie den Spuren desjenigen, von dem sich der Haupttitel des Romans ableitet: Jakob Frank, Anführer einer jüdischen mystischen Bewegung und selbsternannter Prophet, der im achtzehnten Jahrhundert wirkte und dabei so berühmt wie umstritten war. Seine Fähigkeit, Tausende von Anhängern um sich zu scharen, basierte allerdings kaum auf der Tiefe oder Originalität seiner Gedanken, im Gegenteil, seine Lehren waren nur "ein Sammelsurium aus den Theorien der türkischen Sabbatianer und der Kabbalisten". Er verdankte den Erfolg vielmehr seinem Charisma, der Kühnheit seiner Ziele und der Ungewöhnlichkeit der Mittel, zu denen er griff, um sich Gehör zu verschaffen.
Nicht nur dass er die Gesetze des Talmuds ablehnte - er wechselte sogar mehrmals die Religion; er strebte nach einem Leben, das auf Freiheit und Gleichheit der Menschen basieren würde; er wollte seinem Volk zu mehr Selbstbewusstsein und Geltung verhelfen. Seine Anhänger versuchte er davon zu überzeugen, eine Reinkarnation von Schabbatai Zwi, dem Begründer der sabbatianischen Bewegung, zu sein, und danach ging er sogar noch weiter, indem er sich gern als menschliche Inkarnation Gottes inszenierte. Mit dem Ergebnis, dass er von den einen als der neue Messias verehrt, von den anderen als Hochstapler verschrien wurde.
Franks Leben war nicht minder kompliziert als seine Ansichten
Das Leben des 1726 in Korolówka, einem Dorf in Podolien, geborenen Ja'akow Josef ben Jehuda Lejb, wie sein echter Name lautete, war nicht minder kompliziert als seine Ansichten. Es spielte sich zwischen der Polnisch-Litauischen Republik, dem Osmanischen Reich, dem Habsburgerreich, dem Königreich Böhmen und Mähren und dem Heiligen Reich Deutscher Nation ab, und die Städte Bukarest, Istanbul, Saloniki, Warschau, Lemberg, Tschenstochau und Offenbach waren nur die wichtigsten seiner zahlreichen Stationen. Er konvertierte zum Islam, um dann zum Christentum überzutreten und sich gleich zweimal taufen zu lassen, er gewann die Gunst der damaligen Herrscher und verlor sie wieder, er wurde von den Polen der Ketzerei beschuldigt und jahrelang im Klostergefängnis von Tschenstochau gefangen gehalten, von wo er von den Russen befreit wurde. Schließlich kam er mit seiner Gefolgschaft nach Offenbach, wo der Fürst von Isenburg ihm sein Schloss zur Verfügung stellte und wo er sich den Titel eines Barons zulegte. Dort starb er 1791 und geriet in Vergessenheit. Viele Jahre später gelangte sein Schädel nach Berlin, wo er nach einer peniblen Untersuchung "als Beweis der Unterlegenheit der jüdischen Rasse" galt.
Um diese schier unglaublichen Wenden glaubhaft erscheinen zu lassen, stellt Tokarczuk ihrem Protagonisten eine Reihe von Nebenfiguren zur Seite: den katholischen Pfarrer Benedykt Chmielowski, der dem Judentum viel Respekt und Interesse entgegenbringt, die Kastellanin Katarzyna Kossakowska und die Dichterin Elzbieta Druzbacka, die genau die entgegengesetzte Position vertreten, oder den Juden Nachman, einen von Franks Anhängern. Und sie erzählt seine Geschichte in einem Stil, in dem die berichtenden Teile, die sie mit der Nüchternheit und Genauigkeit eines Chronisten gestaltet, mit Passagen versetzt sind, von denen mal eine poetische, mal eine metaphysische Aura ausgeht.
In ein solches Buch gehört natürlich auch eine Portion magischer Realismus, den Olga Tokarczuk schon immer mühelos herbeizuzaubern wusste. Man denke nur an ihren bekanntesten Roman, "Ur und andere Zeiten", dessen Handlungsort, das Dorf Ur, einerseits reale, andererseits phantastische, zuweilen biblische Züge trägt und einen Mikrokosmos bildet, in dem Geist, Materie und Natur fließend ineinander übergehen. In den "Jakobsbüchern" ist es die alte Jenta, Jakobs Großmutter, die für das magische Klima sorgt. Sie liegt bereits im Sterben, doch "plötzlich, als hätte es einen Schlag getan", sieht sie "alles von oben" und, was am wichtigsten ist: "Von nun an bleibt es so - Jenta sieht alles". Als sie schon einen Teil des Romans fertig gehabt habe, gestand einmal die Autorin, sei ihr klar geworden, dass es eine alles koordinierende Instanz brauche, sonst komme sie mit dieser Menge Material nicht zurecht. "Und als ich Jenta hatte", freute sie sich, "fing alles an, Sinn zu ergeben."
Nach einer öffentlichen Rede zur Staatsfeindin erklärt
Mit Jentas Hilfe ist es ihr also gelungen, die Geschichte des "falschen Messias" Jakob Frank zu Ende zu erzählen, was allerdings nicht ihr einziges Anliegen war. Ihr Buch ist ein Pandämonium von Informationen aus Politik und Soziologie, Religions- und Kulturgeschichte, Philosophie und Psychologie, die sich zu einem eindrucksvollen Porträt der damaligen Welt zusammensetzen und von denen sich immer wieder Bezüge zur Gegenwart ableiten lassen. "Die Figur Frank nimmt eine Vielzahl moderner Fragen vorweg", so Olga Tokarczuk. "Begegnung mit dem Fremden, Glaubensübertritte, soziale Emanzipation, selbst Zionismus und Feminismus lassen sich hier finden."
Und nicht zuletzt ist der Roman auch ein Versuch, ein wichtiges Kapitel der polnischen Geschichte neu zu interpretieren. Tokarczuk lässt die polnisch-litauische Adelsrepublik, in der die Handlung spielt, keineswegs als ein solches Paradies erscheinen, als das sie gern, nicht zuletzt aufgrund der historischen Romane von Henryk Sienkiewicz, angesehen wird. Sienkiewicz (Literaturnobelpreisträger von 1905) war zwar keineswegs unkritisch, aber er konzentrierte sich bewusst auf das 17. Jahrhundert, in dem diese Adelsrepublik drei erfolgreiche Feldzüge, gegen die ukrainischen Kosaken, die Schweden und die Türken, führte, was Generationen von seinen Lesern genügte, um jene Zeit zu verherrlichen. Tokarczuk hingegen zeigt diese Republik als einen politisch schwachen Feudalstaat, zu dem Machtmissbrauch durch Hochadel und Klerus, Unterdrückung der ethnischen Minderheiten, Judenpogrome oder sklavenähnliche Ausbeutung der leibeigenen Bauern gehörten.
Als sie es schrieb, ahnte sie vermutlich nicht, dass ihr Buch dadurch eines Tages zu einem Politikum werden würde. Während sie nämlich im Herbst 2015 für die "Jakobsbücher" mit dem Nike, dem wichtigsten polnischen Literaturpreis, ausgezeichnet wurde, fand im Lande ein Regierungswechsel statt: Es begann die Ära der nationalkonservativen Partei "Recht und Gerechtigkeit" (PiS), die der Nation von Anfang an eine eigene, auf Selbstglorifizierung und Stärkung des Patriotismus ausgerichtete Vision ihrer Geschichte aufzuzwingen versuchte. Und so wurde Olga Tokarczuk auf einmal zu einer Staatsfeindin abgestempelt. Als sie dann auch noch in einer vom Fernsehen übertragenen Rede nachlegte, indem sie ihre Landsleute aufforderte, sich den dunklen Kapiteln ihrer Geschichte zu stellen und sich dabei an den Deutschen ein Beispiel zu nehmen, löste sie einen Sturm der Entrüstung aus.
Doch das sind alles Dinge, die für die polnischen Leser von Interesse sind. Wie soll aber diesen, übrigens hervorragend von Lisa Palmes und Lothar Quinkenstein übersetzten, Roman jemand lesen, der weder mit den Details der polnischen Geschichte oder mit den Feinheiten des polnisch-jüdischen Verhältnisses vertraut, noch in Judaistik oder Religionsgeschichte besonders bewandert ist? Nun, durch seine Gliederung und optische Form - er besteht aus sieben Büchern, einunddreißig Teilen und unzähligen kleinen Kapiteln, ist reichlich illustriert, und die Seiten sind in hebräischer Manier rückwärts nummeriert - lädt der Roman geradezu dazu ein, nicht auf einmal gelesen, sondern langsam und aufmerksam studiert zu werden. Eine polnische Kritikerin will sich bei dessen Lektüre wie bei der Betrachtung der Bilder von Pieter Bruegel dem Älteren gefühlt haben - versuchen wir es auch.
MARTA KIJOWSKA
Olga Tokarczuk:
"Die Jakobsbücher".
Aus dem Polnischen
von Lisa Palmes und
Lothar Quinkenstein.
Kampa Verlag, Zürich 2019.
1184 S., geb., 42,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main