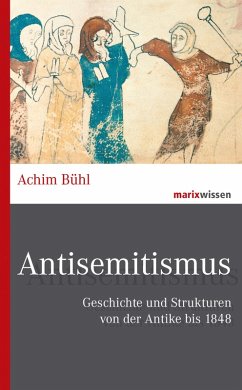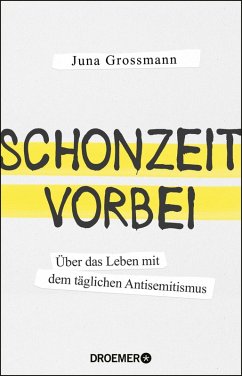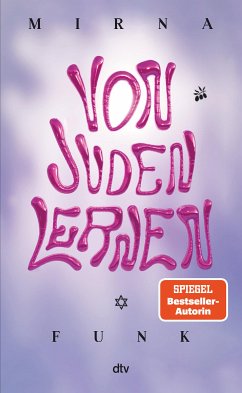Die jüdische Wunde (eBook, ePUB)
Leben zwischen Anpassung und Autonomie
Sofort per Download lieferbar
Statt: 26,00 €**
19,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Das jüdische Dilemma zwischen Assimilation und Eigenständigkeit - von der Aufklärung bis heute Die Deutschen lieben Nathan. Doch Lessings Bühnenfigur konnte die Hoffnung, dass es eines Tages keine Rolle mehr spielen würde, ob jemand Jude sei, nicht erfüllen. Und als Hannah Arendt 1959 den Lessing-Preis entgegennahm, sprach sie sich in ihrer Dankesrede ausdrücklich gegen diese Idee der Assimilation aus, die am Ende zum Verschwinden jüdischer Identität führen würde. Das jüdische Dilemma zwischen Anpassung und Autonomie konnte seit der Aufklärung nicht aufgelöst werden - auch der St...
Das jüdische Dilemma zwischen Assimilation und Eigenständigkeit - von der Aufklärung bis heute Die Deutschen lieben Nathan. Doch Lessings Bühnenfigur konnte die Hoffnung, dass es eines Tages keine Rolle mehr spielen würde, ob jemand Jude sei, nicht erfüllen. Und als Hannah Arendt 1959 den Lessing-Preis entgegennahm, sprach sie sich in ihrer Dankesrede ausdrücklich gegen diese Idee der Assimilation aus, die am Ende zum Verschwinden jüdischer Identität führen würde. Das jüdische Dilemma zwischen Anpassung und Autonomie konnte seit der Aufklärung nicht aufgelöst werden - auch der Staat Israel steht in dieser Spannung zwischen säkularer und religiöser Identität. Natan Sznaider ist überzeugt, dass dieser Widerspruch nie verschwinden wird. Was spricht dagegen, ihn zu akzeptieren und anzuerkennen, dass wir immerhin als Ungleiche gleich sind?
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, L ausgeliefert werden.