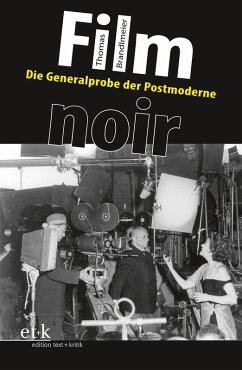Die Kameraaugen des Fritz Lang (eBook, PDF)
Der Einfluss der Kameramänner auf den Film der Weimarer Republik. Studien zu Karl Freund, Carl Hoffmann, Rudolph Maté, Günther Rittau und Fritz Arno Wagner
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 39,00 €**
38,99 €
inkl. MwSt.
** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Der Film der Weimarer Republik hat einen großen Einfluss auf die Filmgeschichte ausgeübt. International anerkannt sind bis heute besonders die bildgestalterischen Meisterleistungen dieser Jahre. Die Sprache der bewegten Bilder emanzipierte sich im Film der Weimarer Republik von den tradierten Formen der Bildgestaltung aus Malerei und Fotografie, und auch die Spannung zwischen visueller Gestaltung und erzählerischer Dramaturgie, zwischen Kamera und Regiearbeit, beflügelte beide Seiten zu Innovation und Kreativität. Der Filmhistoriker Paul Rotha vertrat gar die These, dass jedes fotografisc...
Der Film der Weimarer Republik hat einen großen Einfluss auf die Filmgeschichte ausgeübt. International anerkannt sind bis heute besonders die bildgestalterischen Meisterleistungen dieser Jahre. Die Sprache der bewegten Bilder emanzipierte sich im Film der Weimarer Republik von den tradierten Formen der Bildgestaltung aus Malerei und Fotografie, und auch die Spannung zwischen visueller Gestaltung und erzählerischer Dramaturgie, zwischen Kamera und Regiearbeit, beflügelte beide Seiten zu Innovation und Kreativität. Der Filmhistoriker Paul Rotha vertrat gar die These, dass jedes fotografische Mittel, das die dramatische Kraft der Einstellung unterstützt, seinen Ursprung in den Filmstudios der Weimarer Republik hat. Allerdings wurde bis heute nie genau analysiert, wie die Wirkung und Aussagekraft dieser Bilder handwerklich und künstlerisch hergestellt wurde und wie die sich rasant entwickelnde Filmtechnik zu immer neuen bildsprachlichen Experimenten führte. Anhand von neun Filmausschnitten diskutiert Axel Block die Frage, welchen Einfluss Kameramänner wie Karl Freund, Carl Hoffmann, Rudolph Maté, Günther Rittau und Fritz Arno Wagner auf den Film der Weimarer Republik ausübten und wie dabei die Zusammenarbeit mit den Regisseuren funktionierte. In den Blick kommen dabei nicht nur mehrere Filme Fritz Langs, darunter "Dr. Mabuse, der Spieler" (1921/22), "Metropolis" (1925/26) und "M - Eine Stadt sucht einen Mörder" (1931), sondern auch weitere Klassiker wie F. W. Murnaus "Der letzte Mann" (1924), G. W. Pabsts "Die Liebe der Jeanne Ney" (1927) und Joseph von Sternbergs "Der blaue Engel" (1929/30). Abgerundet werden die Analysen mit ihrem Fokus auf Bildgestaltung, Bewegung, Lichtführung und Korrespondenz zur Inszenierung und Dramaturgie mit einem umfangreichen Glossar, in dem zahlreiche Fachausdrücke und handwerkliches Grundwissen erläutert werden.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.