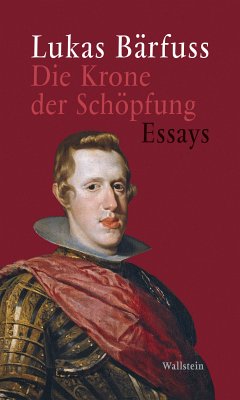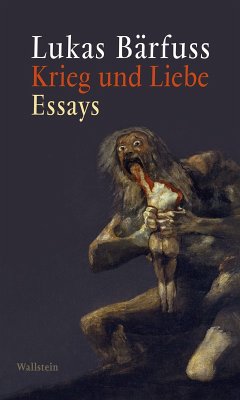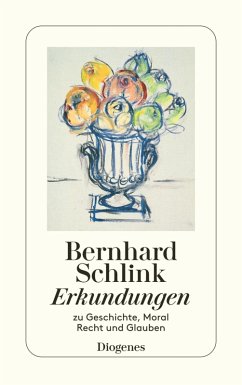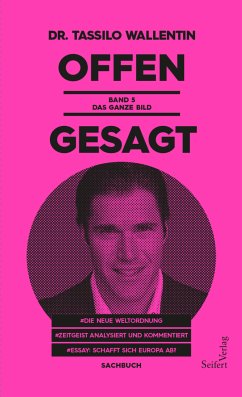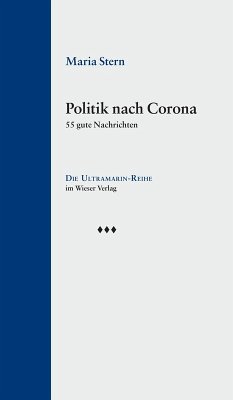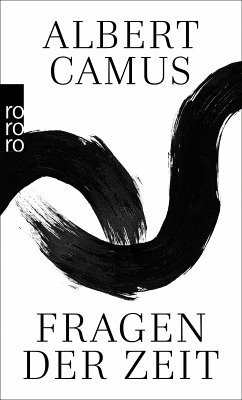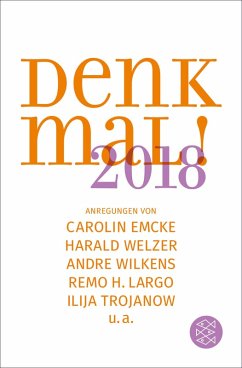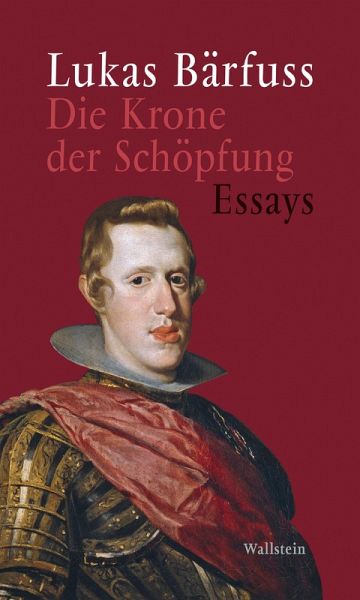
Die Krone der Schöpfung (eBook, ePUB)
Essays
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 22,00 €**
15,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
In seinen Kolumnen äußert sich Lukas Bärfuss zu vielfältigen, aber immer drängenden Fragen unserer Zeit. "Die Geschichte bewegt sich nicht im Ochsengang, nicht in einem gleichmäßigen Trott. Sie gleicht eher den wilden Sprüngen eines Pferdes, das nach Tagen im Stall wieder auf die Weide gelassen wird", heißt es bei Lukas Bärfuss. Und er unterzieht sie in seinen Kolumnen 2019/2020 gewissermaßen in Echtzeit seinem prüfenden Blick, etwa wenn er sich staunend klarmacht, was eigentlich das wirklich Neue an einem eben auf den Markt kommenden iPhone ist: nichts Wesentliches, und wenn er da...
In seinen Kolumnen äußert sich Lukas Bärfuss zu vielfältigen, aber immer drängenden Fragen unserer Zeit. "Die Geschichte bewegt sich nicht im Ochsengang, nicht in einem gleichmäßigen Trott. Sie gleicht eher den wilden Sprüngen eines Pferdes, das nach Tagen im Stall wieder auf die Weide gelassen wird", heißt es bei Lukas Bärfuss. Und er unterzieht sie in seinen Kolumnen 2019/2020 gewissermaßen in Echtzeit seinem prüfenden Blick, etwa wenn er sich staunend klarmacht, was eigentlich das wirklich Neue an einem eben auf den Markt kommenden iPhone ist: nichts Wesentliches, und wenn er dann aber resümiert, welche grundstürzenden Dinge passiert sind in den wenigen Jahren, die es dieses Telefon überhaupt erst gibt. Seit 2008 nämlich. Das Kleine und das Große sind auf eine verblüffend einleuchtende Weise miteinander verzahnt. Bärfuss springt in seinen Themen, mal ist er analytisch kühl, mal argumentiert er leidenschaftlich polemisch, ob es um Corona geht oder um die Gleichberechtigung der Frauen, um Identitätspolitik, um die USA, China, den Brexit und immer wieder um die Schweiz. Durchaus bemerkt er, dass die ständigen Veränderungen den Menschen Angst machen können, aber dennoch macht er als die größere Gefahr die Stagnation aus. Als wacher Zeitgenosse will er sich einmischen, als genauer Beobachter und denkender Mensch, der Politisches und Poetisches in der Tradition Heinrich Heines zusammenbringt.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.