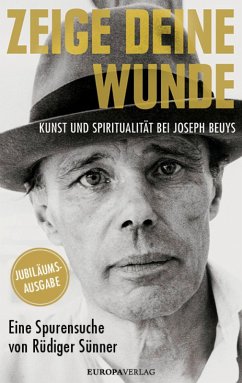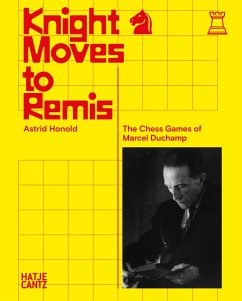Die Kunst nach dem Ende ihrer Autonomie (eBook, ePUB)
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 22,00 €**
17,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Broschiertes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Das in der Moderne im Westen vorherrschende Ideal autonomer Kunst ist am Ende. Unterscheidungen zwischen Kunst und Kommerz lösen sich ebenso auf wie fest umrissene Werkgrenzen und Rollenklischees: Jeff Koons entwirft Taschen für Louis Vuitton, Künstler-Labels produzieren »Art Toys«, kollaborative Projekte setzen auf die Mitwirkung vieler, und Protestgruppen fordern mehr soziale Verantwortung der Kunstwelt. Mit wacher Zeitgenossenschaft führt Wolfgang Ullrich einzelne Phänomene wie beispielsweise Make-up-Fotos auf Instagram, die utopische Malerei von Kerry James Marshall und Takashi Mura...
Das in der Moderne im Westen vorherrschende Ideal autonomer Kunst ist am Ende. Unterscheidungen zwischen Kunst und Kommerz lösen sich ebenso auf wie fest umrissene Werkgrenzen und Rollenklischees: Jeff Koons entwirft Taschen für Louis Vuitton, Künstler-Labels produzieren »Art Toys«, kollaborative Projekte setzen auf die Mitwirkung vieler, und Protestgruppen fordern mehr soziale Verantwortung der Kunstwelt. Mit wacher Zeitgenossenschaft führt Wolfgang Ullrich einzelne Phänomene wie beispielsweise Make-up-Fotos auf Instagram, die utopische Malerei von Kerry James Marshall und Takashi Murakamis Sneaker zusammen und entfaltet so das Panorama einer neuen Kunst, die sich mit Aktivismus und Konsum verbündet: einer Kunst, die Kräfte möglichst vieler Disziplinen in sich bündelt, damit aber anderen und mehr Kriterien als früher zu genügen hat.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.