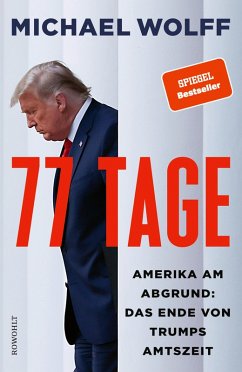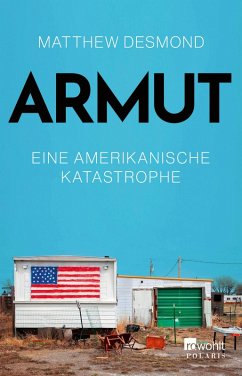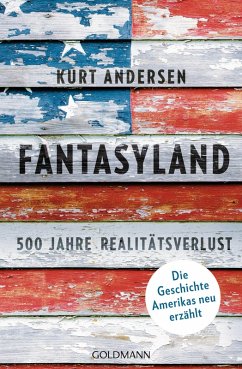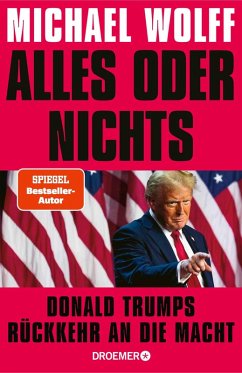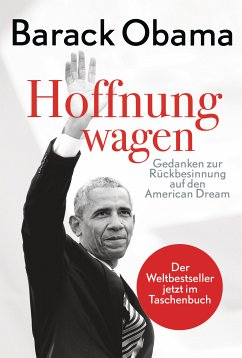Die letzte beste Hoffnung (eBook, ePUB)
Zum Zustand der Vereinigten Staaten
Übersetzer: Liebl, Elisabeth

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
George Packer beschreibt, was im Jahre 2020 aus Amerika geworden ist - ein failed State: Corona und gestapelte Särge, Black Lives Matter und George Floyd, der Kampf um Identitäten, eine unfähige Regierung. Vereinigt ist an diesen Staaten nichts mehr. Packer blickt zurück auf die jüngste Geschichte der USA, in der die ganz unterschiedlichen Amerikas immer weiter in Konflikt geraten sind. So sehr, dass das große Experiment der amerikanischen Demokratie vor dem Scheitern steht. Packer spannt in diesem eindringlichen Essay den Bogen von Tocqueville bis Trump und zeigt, wie sehr die Krise der...
George Packer beschreibt, was im Jahre 2020 aus Amerika geworden ist - ein failed State: Corona und gestapelte Särge, Black Lives Matter und George Floyd, der Kampf um Identitäten, eine unfähige Regierung. Vereinigt ist an diesen Staaten nichts mehr. Packer blickt zurück auf die jüngste Geschichte der USA, in der die ganz unterschiedlichen Amerikas immer weiter in Konflikt geraten sind. So sehr, dass das große Experiment der amerikanischen Demokratie vor dem Scheitern steht. Packer spannt in diesem eindringlichen Essay den Bogen von Tocqueville bis Trump und zeigt, wie sehr die Krise der USA auch eine der westlichen Gesellschaften ist. Sein Buch ist ein leidenschaftlicher Text darüber, wie Amerika sich retten kann. Wenn es sich darauf besinnt, was es einmal gewesen ist - ein Land, in dem jeder es schaffen kann. Packers Text über die Demokratie in Amerika ist ein Weckruf.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.