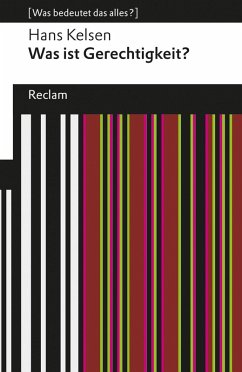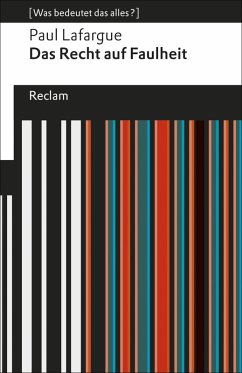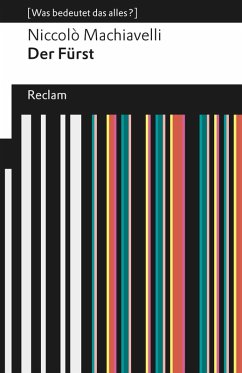Die Macht der Menschenbilder. Wie wir andere wahrnehmen (eBook, ePUB)
[Was bedeutet das alles?] - Zichy, Michael - Erläuterungen - Denkanstöße - Analyse
Sofort per Download lieferbar
Statt: 7,00 €**
6,99 €
inkl. MwSt.
** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Menschenbilder haben Macht über uns. All unser Denken und Verhalten wird durch bestimmte Vorannahmen, was und wie ein Mensch zu sein hat, beeinflusst. Denn Menschenbilder sind fundamental für eine Gesellschaft - sie durchziehen ihre Ordnungen, ihre Moral, ihr Rechtssystem, ihre Pädagogik. Menschenbilder bilden den Menschen nicht einfach nur ab, sie bilden ihn vielmehr mit: Menschenbilder sind konstitutiv für die Art und Weise, wie wir Menschen sind. Die eklatanten Folgen gilt es zu bedenken.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.