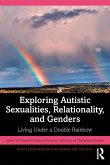Ehrenberg zeigt, dass die kognitive Neurowissenschaft und die mit ihr verbundene Verhaltensökonomie ihre wachsende Autorität nicht nur aus ihren wissenschaftlichen Ergebnissen, sondern auch aus der Einschreibung in ein wichtiges soziales Ideal bezieht: das eines Individuums, das seine Unzulänglichkeiten durch Nutzung seines »verborgenen Potentials« in verwertbare Vermögen umzuwandeln vermag. Diese neue Wissenschaft vom Verhalten ist für Ehrenberg daher die Echokammer unserer zeitgenössischen Ideale der Autonomie.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.

Das Gehirn als Spiegel des liberalen Individualismus: Alain Ehrenberg zeigt, wie die Neurowissenschaften am Selbst arbeiten
Ehrenberg ist ein französischer Soziologe, der sich für zwei Dinge interessiert: das Ich und die Gesellschaft. Dass er sich für die Gesellschaft interessiert, wundert einen nicht, dass er sich für das Ich interessiert, schon. Das Ich ist traditionell Gegenstand der Psychologie. Für Ehrenberg aber sind die beiden nicht zu trennen. Wie sie verbunden sind, dieser Frage hat er seine Forschungen gewidmet. Dabei geht er weit über Theorien der Sozialisation hinaus. Er betreibt eine Soziologie der Psychologie, der Psychotherapie, Psychoanalyse und der Varianten der Neurologie.
Sein letztes Buch, "Das Unbehagen in der Gesellschaft", handelte von der Vermessung des Selbst in Frankreich und in Amerika in den Jahrzehnten, als die Ich-Psychologie und die Psychoanalyse des französischen Stars Jacques Lacan das Sagen hatten. In seinem neuen Buch geht er chronologisch weiter zu den Neurowissenschaften, die das Selbst erobern. Auch diese aktuelle Erforschung von Ich und Geist, Verhalten und Gehirn, geschieht nicht im luftleeren Raum, sondern in einer Gesellschaft, deren Ideale sich auch in den neuen Konzepten des Selbst unterschwellig niederschlagen.
Psychologen haben es nach Ehrenberg nicht mit "dem" Menschen zu tun, sondern mit einem zu erforschenden sozialisierten Menschen. Neurobiologen haben es nicht mit "dem" Gehirn zu tun, sondern mit einem zu erforschenden sozialisierten Gehirn. Beide, Mensch und Gehirn, sind komplizierte Spiegelungen der Gesellschaft, zu der auch die Forscher und ihre Wissenschaften gehören. Die Aufgabe eines Soziologen kann darin bestehen, diesen Zusammenhang aufzudecken.
Die Nahtstelle, die Ich und liberale Gesellschaft verbindet, ist der Individualismus. Die liberale Gesellschaft braucht ihn als Motor, der ihre Mitglieder antreibt, sich auf dem Markt der Möglichkeiten und der Arbeit zu verwirklichen. Auch das Selbst braucht ihn als Motor, der es dazu antreibt, gerade in der liberalen Gesellschaft sein Glück zu versuchen. Alain Ehrenberg sieht den Urtypus des auf seine Eigenarten und seine besonderen Fähigkeiten pochenden Ichs, das am liebsten autonom wäre, im Künstler des neunzehnten Jahrhunderts, der versuchen musste, seine Individualität auf dem Umschlagplatz der Waren durchzusetzen. Der Dichter Baudelaire habe ihm ein erstes Denkmal gesetzt.
Seine Soziologie der Neurowissenschaften schreibt Ehrenberg entlang dem Gespräch, das die Neurowissenschaften über Geist, Gehirn und Verhalten in wissenschaftlichen Studien, Forschungsprojekten und Bestsellern führen und unter die Leute bringen, die von sich aus nie auf den Gedanken gekommen wären, den Geist im Gehirn aufgehen zu lassen, so wenig, wie sie ein Lacan'sches Begehren oder ein Freud'sches Es erfunden hätten. Mit den Wissenschaften aber sind all diese Dinge, so zart, luftig und unausgegoren sie sein mögen, in die Welt gekommen. Dass sie dort nicht als Fremdkörper wahrgenommen werden, dass sie dort vielmehr auf Resonanz stoßen und sich durchsetzen, genau dieser Nachweis macht eine Soziologie des Selbst aus. Die neuen Wissenschaften vom Menschen, die an der Materialisierung des Geistes und an der Mechanisierung der Gefühle arbeiten, sind für Ehrenberg keine Art Unfall im normalen Gang der Dinge, sondern ein Phänomen, das der liberalen Gesellschaft entspricht.
In einem frühen Bestseller des amerikanischen Neurowissenschaftlers António Damásio findet er die publikumswirksame Urszene für das Forscherinteresse am Gehirn. Jedem Leser wurde auf diesen gut verständlichen Seiten sofort klar, dass hier etwas Neues, ein Abenteuer begann, bei dem er selbst eine Rolle spielen würde. Auch der Leser hatte ein Ich, auch er hatte ein Gehirn, über deren Zusammenhänge er neu würde nachdenken können. Die Folgen dieser Verbindung waren noch nicht absehbar.
Die Geschichte, die Damásio erzählt, beginnt in Vermont im Sommer 1848, als dem Arbeiter Phineas Gage bei einer Explosion eine Eisenstange durch den Kopf getrieben wurde. Er überlebte den Unfall, war aber nach seiner Genesung zur Verwunderung seiner Angehörigen und Freunde nicht mehr derselbe. Bestimmte Fähigkeiten wie Sprechen und Rechnen waren zwar intakt geblieben, aber seine Persönlichkeit hatte sich durch die Beschädigungen des Gehirns verändert. Gage war ein arbeitsamer und pflichtbewusster Mensch gewesen, freundlich und verlässlich. Nach dem Unfall wurde er mehr als unleidlich, er schimpfte wild, beleidigte andere heftig und wechselte ständig seine Arbeit. Offenbar vermochte er etwas nicht mehr, was grundlegend war für das Überleben in der Gesellschaft, die ihn einst geschätzt hatte: Es war ihm nicht mehr möglich, für seine eigene Zukunft zu sorgen, gute Entscheidungen zu seinem Wohl zu treffen. Zu diesem Schluss kamen amerikanische Neurowissenschaftler lange nach seinem Tod, als sie das beschädigte Gehirn rekonstruierten, um nach einer Erklärung für sein Verhalten zu suchen, das ihnen als soziales Versagen in die Augen stach. Nach Ehrenberg war diese Analyse beeinflusst von einer Art Kurzschluss, wie er üblich ist in einer Gesellschaft, in der ein Selbst an sich arbeiten und sich kontrollieren muss, wenn es sozial bestehen will.
Der Fall Gage weckte den Gedanken, dass die Schuld für soziales Versagen nicht unbedingt beim Einzelnen und dessen Vorsätzen lag, sondern offenbar auf ein beschädigtes Gehirn zurückgeführt werden konnte. Diese Deutung verschob die Koordinaten des Selbst. Sie verschaffte Menschen, die nie mit sich zufrieden sind, Erleichterung vom psychischen Druck, sich ständig verbessern zu müssen. Gleichzeitig öffnete sie die Aussicht, soziale Grenzgänger, Versager, alte Psychofälle als Menschen mit einem Gehirnschaden zu klassifizieren, der medizinisch behandelt werden könnte. Die Arbeit am Selbst, an der sich bislang nur die eigene Psyche und ein Psychotherapeut beteiligt hatten, wurde zu einer Sache des Gehirns und der Neurowissenschaftler.
Die Psyche lässt sich kneten, formen und bearbeiten. Davon erzählt die Geschichte der Psychotherapie. Das weitgehend unerforschte Gehirn aber, das mehr Rätsel stellt als Lösungen preisgibt, macht unverrückbare Vorgaben. Mit ihnen könnten sich Patienten abfinden, wenn sie sich davon überzeugen ließen, dass in einem Mangel, in einem Handicap eine Chance liegt. Dem Blick des Soziologen Ehrenberg entging nicht, dass sich hier auf Patientenebene durchsetzt, was zu den Idealen einer liberalen Gesellschaft gehört: Mach etwas aus dir. Der Neurowissenschaftler würde umstandslos ergänzen: Mach etwas aus dir, so wie du bist. Psychische Krankheiten sind jetzt nicht mehr nur ein zu behebender Defekt, der sich von dem Hintergrund der Normalität abhebt. Patienten sollen sie als eine Chance zur Individualisierung verstehen, die ihnen willkommen sein müsste, da sie eine ganze Gesellschaft in Atem hält. Ein Autist mag auf vielen Feldern der psychischen Möglichkeiten scheitern. Dafür zeichnet er sich auf einem anderen besonders aus, das er als sein individuelles Potential schätzen lernen kann. Selbsterkenntnis durch Reflexion und viele Gespräche waren ein Weg zu einem vielleicht besseren Leben. Doch wo Verhalten und Lernen zu Folgen von regelmäßigen Übungen und neuronalen Prägungen erklärt werden, da sieht sich der Psychotherapeut dazu gedrängt, dem therapeutisch stur und verlässlich agierenden Computer seinen Platz zu überlassen. Ehrenberg hat einen nüchternen Sinn für Pointen, in denen sich Entwicklungen verdichten. Im August 2015, so erzählt er in seinem Buch, habe der Leiter des National Institute of Mental Health erklärt, dass sich Technologiefirmen erfolgreich in der biomedizinischen und psychiatrischen Forschung, bei Verhaltensprognose und therapeutischen Trainingspraktiken betätigen könnten. Zwei Wochen später wechselte er zu Google Life Sciences, um dort die Ideen umzusetzen, die ihm vorschwebten, und Konzepte zu entwerfen, wie mit Hilfe von digitalen Techniken Geisteskrankheiten erkannt und ihnen vorgebeugt werden könnten.
Die Neurowissenschaften betonen gerne, dass sie noch in den alles versprechenden Anfängen stecken, dass sie noch einen langen Weg vor sich haben, bis ihnen die Auflösung des Geistes im geheimnislosen, offengelegten Gehirn gelungen sei. Schon ihr Aufstieg weckte nicht nur bei Forschern und Patienten wilde und vage Hoffnungen, sondern setzte auch staatliche Programme in eine Welt, in der nicht weiterkommt, wer den Anschluss an Neues verpasst. Das gilt auch für Regierungen, die wissen wollen, wie ihre Bürger ticken, weil sie gerade auf deren aktive Mitwirkung am Gelingen einer liberalen Gesellschaft nicht verzichten können. Die Abkürzung BRAIN für Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies bezeichnete, so Ehrenberg, eine Initiative der Obama-Regierung, die im April 2013 gestartet wurde. Ihr Ziel war herauszufinden, wie sich Unterschiede zwischen Gehirnen in unterschiedlichen Verhaltensweisen, Emotionen und Erfahrungen ausdrücken würden. Eine Datenbank wurde eingerichtet, die dazu dienen sollte, psychische Krankheiten besser zu erkennen, besser zu verstehen und besser zu klassifizieren. In den Träumen von Psychoanalytikern ohne Datenbank, die Ergänzung liegt nahe, wird Obama nicht mehr aufgetaucht sein.
Ehrenberg nennt das Wesen, das die Neurowissenschaften zu erkunden begonnen haben, den neuronalen Menschen. Mit ihm scheint sich der alte Dualismus zwischen Geist und Körper aufzulösen. An seine Stelle, so der Soziologe der säkularisierten liberalen Gesellschaft, könnte eine Einheit naturalistischen Wissens treten, ein Monismus der Sozialisation, der nichts und keiner entgeht. Biologie, Psychologie und Soziologie werden zusammenfinden, so wie Gehirn, Ich und Gesellschaft nicht getrennt werden können. Wenn es so weit in der Selbstbeschreibung des Menschen gekommen ist, gibt es keine Ausflüchte ins Absolute mehr, keine transzendentalen Schlupflöcher. Die Welt ist dicht. Die Figur, die sich hier abzeichnet, nennt Ehrenberg den totalen Menschen, dessen Wesen und Sein von der Gesellschaft geschaffen wird. Mit ihm erfüllt sich auch sein eigenes Forschungsprogramm, dass die letzte Geschichte und Entwicklung des Selbst in Psychologie und Biologie, in Psychotherapie, Psychoanalyse und Neurowissenschaften, ohne die Vorgaben, Ideale und Traditionen einer liberalen Gesellschaft nicht zu verstehen ist. "Die Mechanik der Leidenschaften" ist ein ungewöhnlich anregendes und erhellendes Buch.
EBERHARD RATHGEB
Alain Ehrenberg: "Die Mechanik der Leidenschaften. Gehirn, Verhalten, Gesellschaft". Aus dem Französischen von Michael Halfbrodt. Suhrkamp, 429 Seiten, 34 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH