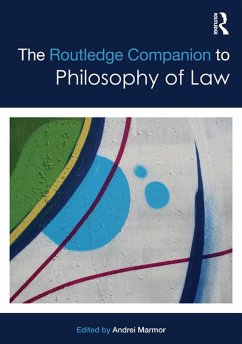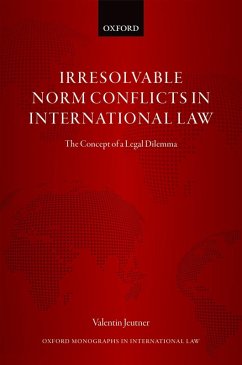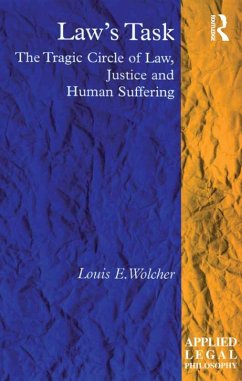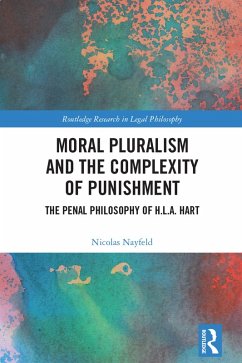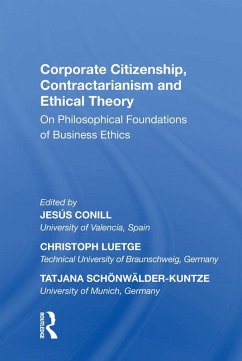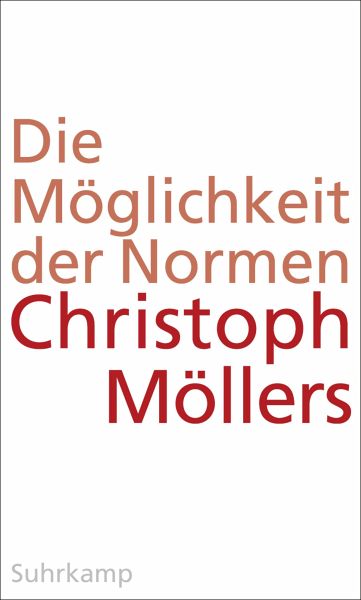
Die Möglichkeit der Normen (eBook, ePUB)
Über eine Praxis jenseits von Moralität und Kausalität
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 26,00 €**
25,99 €
inkl. MwSt.
** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Normen, so könnte man meinen, verlangen stets bestimmte Handlungen oder Unterlassungen und erfordern eine moralische Rechtfertigung. Christoph Möllers bestreitet das und behauptet, dass unser Umgang mit Normen an falschen Erwartungen leidet. Wir überfordern die Praxis des Normativen mit moralischen Ansprüchen und mit Hoffnungen auf Wirksamkeit. In seinem vieldiskutierten Buch entwickelt Möllers eine neue Sicht auf Normen und zeigt, welchem Zweck sie wirklich dienen. Darüber hinaus befasst er sich im neuen Nachwort zu dieser Ausgabe mit kritischen Einwänden gegen seine Theorie.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.