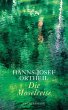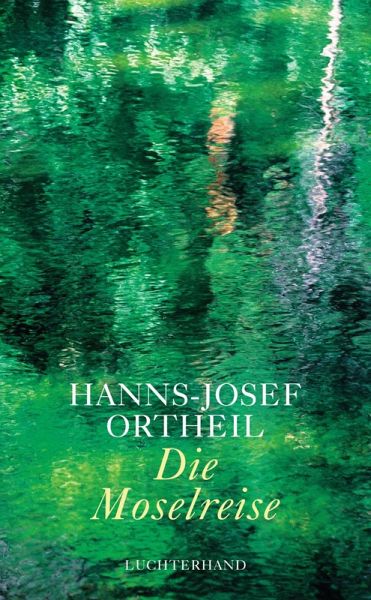
Die Moselreise (eBook, ePUB)
Roman eines Kindes
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 16,99 €**
13,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Im Zentrum dieses ungewöhnlichen Buchs steht das Tagebuch einer Moselreise, das Hanns-Josef Ortheil als Elfjähriger verfasst hat und das erkennen lässt, wie wichtig für den kleinen Jungen schon das Reisen, die Sprache und das Schreiben waren. Ergänzt wird dieses beeindruckende Dokument durch die Beschreibung derselben Reise, die der Autor Jahrzehnte später unternommen hat. Den Abschluss des Buchs macht eine Erzählung darüber, warum Ortheil in seinem Leben bestimmte Landschaften und Gegenden immer wieder aufsucht. So führt die Erzähltrias der »Moselreise« den grandiosen Künstlerrom...
Im Zentrum dieses ungewöhnlichen Buchs steht das Tagebuch einer Moselreise, das Hanns-Josef Ortheil als Elfjähriger verfasst hat und das erkennen lässt, wie wichtig für den kleinen Jungen schon das Reisen, die Sprache und das Schreiben waren. Ergänzt wird dieses beeindruckende Dokument durch die Beschreibung derselben Reise, die der Autor Jahrzehnte später unternommen hat. Den Abschluss des Buchs macht eine Erzählung darüber, warum Ortheil in seinem Leben bestimmte Landschaften und Gegenden immer wieder aufsucht. So führt die Erzähltrias der »Moselreise« den grandiosen Künstlerroman »Die Erfindung des Lebens« fort und gibt faszinierende Einblicke in die Geheimnisse jener frühsten, familiären Bindungen, die einen Menschen lebenslang prägen.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.