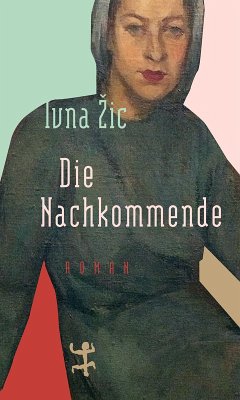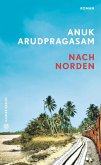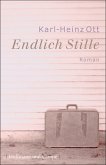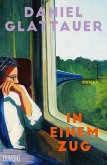Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Vom Weinen zum Wein: Ivna Zics Roman "Die Nachkommende"
Die Toten steigen kurz vor Zagreb in den Zug ein: "Da hocken sie neben mir und nehmen nach und nach das ganze Abteil ein, das kann ja wieder einmal gut werden." Die schielende Großtante, der zahnlose, bucklige Großonkel und viele mehr. Sie machen der jungen Frau, die für den Sommer in die alte Heimat der Familie fährt, die üblichen Vorwürfe, wittern Verrat und eine Abkehr von der Kultur, der sie entstammt. Ihr Großvater aber hält sich da raus. "Seine Stille entwickelt eine Kraft, nimmt den Raum ein und lässt die anderen kleiner werden. Er grüßt mich, setzt sich nun neben mich, und wir werden zusammen in dieser Stadt ankommen."
Es geht um Herkunft in diesem ersten Roman der Theaterautorin Ivna Zic, geboren 1986 in Zagreb und aufgewachsen in Zürich, um Heimat und die Frage, was man den Menschen schuldet, die dort geblieben sind, während man selbst längst weitere Kreise zieht, um Erinnerung, die eigene und die der anderen, und um Sprache, die erworben wird, verlorengeht und immer wieder aufs Neue bestätigt werden muss.
"Die Nachkommende", so der Titel des Romans, folgt keiner exakten Chronologie und lässt auch topographisch an entscheidenden Stellen die Dinge im Unklaren. Die Eisenbahnfahrt der Einleitung jedenfalls wird schon bald von Erinnerungsbildern der Erzählerin überlagert: an den vorigen Sommer zum Beispiel und an das Kennenlernen eines älteren, verheirateten Mannes, der sich um sie bemüht und doch zugleich Distanz wahrt, auch wenn er ihr beim ersten Treffen zu zweit sagt, der Umgang mit ihr habe ihn so "berührt", dass er glaube, zu Hause davon erzählen zu müssen. An die jüngst in Paris mit dem Geliebten verbrachten Tage - sie fuhr dorthin, erinnert sie sich, "um vielleicht eine Entscheidung zu treffen", und zwischen dem vagen "vielleicht" und dem entschlossenen "Entscheidung" auf so engem Raum ist die Zerrissenheit der Erzählerin auch sprachlich aufgehoben. Und an Familiengeschichten, die von Zusammenhalt und von Geheimnissen bestimmt sind, allen voran der Frage, warum der geliebte Großvater, der in jungen Jahren von Zagreb nach Paris ging, um dort Maler zu werden, plötzlich die Kunst sein ließ.
Irgendwann, so heißt es, habe er alle seine Bilder zerstört bis auf das einer sitzenden Frau in Türkis, von dem die Großmutter behauptet, sie wisse nicht, wer das sei. Die Erzählerin kennt ihn als großen Geschichtenerzähler, aber auch als ängstlich und unpraktisch, er habe eben "aufgehört" im umfassenden Sinn. Und irgendwann schimmert durch diesen Text, dass sich auch die Erzählerin die Frage stellt, ob sie nicht besser aufhört in ihrem Bemühen um Kunst und mit dem Wegstreben von der früheren Heimat, in der die Mutter sagt: "Wir sind im Sommer immer zusammen", was Beschreibung ist und zugleich Befehl.
"Schreibst du noch?", wird sie manchmal von denen, die sie früher kannten, gefragt, worauf sie unterschiedliche Antworten oder auch keine findet, und "Kommen Sie von hier?" fragen diejenigen, die sie in der alten Heimat neu kennenlernt. Ihre Antwort: "Ich komme hierhin."
Tatsächlich ist dieses Spiel mit der Sprache oder gleich mit mehreren, das Aufnehmen und Verwandeln von Worten ein wesentliches Stilmittel des Romans, das die Autorin gekonnt und unangestrengt einsetzt. Aus ihrem Weinen wird Weißwein, aus der Feststellung, dass etwas bleibt, wird der Imperativ "bleibt!", und um die gewachsene Entfremdung von ihren Freundinnen auszudrücken, mit denen sie einst so eng war, sagt die Heimkehrerin: "Wir erzählen nicht mehr zusammen, nur noch davon."
Diese Geschichten, die sich überlagern und darin unklar bleiben, ob man etwas selbst erlebt oder davon gehört hat, sind ein Herzstück des Romans, und die Erzählerin, erkennbar auf der Suche nach einer Haltung zu den Dingen und zugleich im Unklaren, ob sie eine solche Haltung überhaupt besitzen möchte, sieht diese Geschichten auch nicht als verbindliche Fassungen des Vergangenen an. Eher ist es ein Ausprobieren, so wie sie, zurück in Kroatien, sich der Worte von damals wieder vergewissern muss. Dass sie damit an kein Ende kommt, macht den großen Reiz und den ästhetischen Genuss an diesem Roman aus.
TILMAN SPRECKELSEN
Ivna Zic: "Die Nachkommende". Roman.
Verlag Matthes & Seitz, Berlin 2019. 168 S., geb., 20,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main