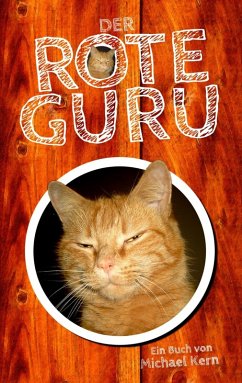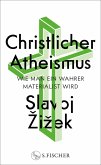Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur WELT-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Daniele Gigliolis Essay über die "Opferfalle"
Wer sich als Opfer darstellt, entzieht sich teilweise der Kritik seines Handelns. Sein Selbstverständnis wird bestimmt von dem, was ihm angetan worden ist. Er beruft sich nicht auf Autonomie, die Fähigkeit, selbst zu entscheiden, sondern auf Authentizität. Je schwerer es fällt, in politischen und sozialen Konflikten zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit zu unterscheiden, desto größer ist die Versuchung, als Opfer aufzutreten oder sich auf deren Seite zu schlagen.
Das notwendige Gedenken vergangenen Unrechts wird, so die These des Literaturwissenschaftlers Daniele Giglioli in seinem Essay "Die Opferfalle", oftmals zum Ritual, das den Blick in die Zukunft versperrt. An die Stelle vernünftiger Diskurse trete dann die Konkurrenz wirklicher oder auch vermeintlicher Opfer. Giglioli geht es nicht um eine anthropologische oder psychologische Kritik einer ubiquitären Opferideologie, sondern darum, die historische Situation zu analysieren, in der sie sich endgültig durchzusetzen begann: die siebziger Jahre. Selbstverständlich kannten auch der Nationalismus des neunzehnten und frühen zwanzigsten Jahrhunderts und die Arbeiterbewegung den Märtyrerkult, doch zum Paradigma politischer Diskussionen wurde die Opferrhetorik, scheinbar paradox, erst in dem Jahrzehnt, das erfüllt war von großen Versprechungen und Hoffnungen.
Giglioli beschreibt die siebziger Jahre als die Epoche, in der die protokapitalistische Ethik der Askese aufgrund der ökonomischen Entwicklung endgültig von der Propaganda möglichst schneller Wunscherfüllung verdrängt wurde. Das Versprechen schrankenlosen Glücks aber führe notwendig, wenn die Frustration nicht als Verzicht rationalisiert werden kann, zur Unfähigkeit, die Enttäuschung zu verarbeiten. Je deutlicher wird, dass das Gewünschte nicht zu erreichen ist, desto hartnäckiger wird die imaginierte Gerechtigkeit eingefordert. Da der Weg fundamentaler politischer Veränderungen aber versperrt zu sein scheint, trete links wie rechts an die Stelle aktiven Handelns die Beschwörung der eigenen unschuldigen Passivität.
Gigliolis Essay ist keine Denunziation derjenigen, die sich - wie berechtigt auch immer - unterdrückt oder verfolgt fühlen. Hinter dem Prestige, das Opfer beanspruchen und erlangen, erkennt er die falsche Antwort auf eine richtige Frage. Statt scheinbar alternativlose Systemzwänge zu akzeptieren, appelliert die Opferethik an die Verantwortung von Subjekten, auch wenn diese die eigene leugnen. Sie beharrt auf dem Recht jedes Einzelnen, jeder diskriminierten Gruppe, in ihrer spezifischen Erfahrung von Leid anerkannt zu werden. Hinter dem falschen Stolz verberge sich immer ein Rest des legitimen. Diese letzte dialektische Volte Gigliolis wird nicht jeden überzeugen, denn die assoziative, manchmal sprunghafte Argumentation lässt die Frage unbeantwortet, wer im konkreten Fall Anspruch auf Unterstützung, Solidarität oder zumindest Mitleid hat. Die Kritik imaginierter Hilflosigkeit kann die Analyse realer Gewaltverhältnisse nicht ersetzen. Dennoch, mit seinen pointierten Anmerkungen zu einem wichtigen Topos politischer Rhetorik ist es ein anregendes Buch.
GERD SCHRADER.
Daniele Giglioli: "Die Opferfalle". Wie die Vergangenheit die Zukunft fesselt.
Aus dem Italienischen von Max Henninger. Matthes & Seitz, Berlin 2016, 127 S., geb., 14,90 [Euro]
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main