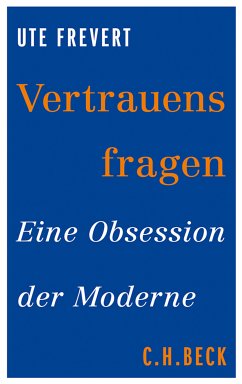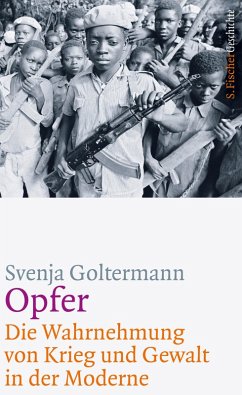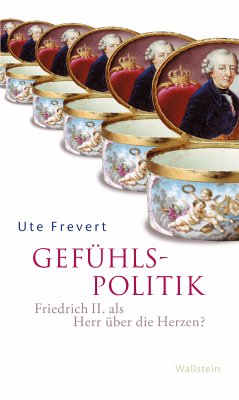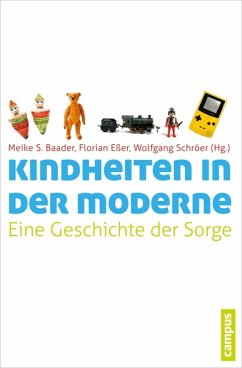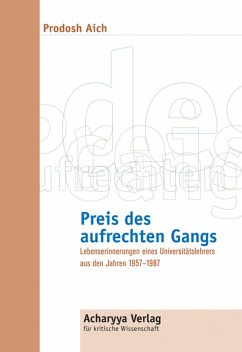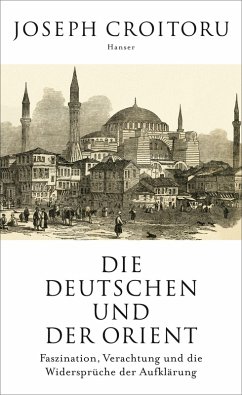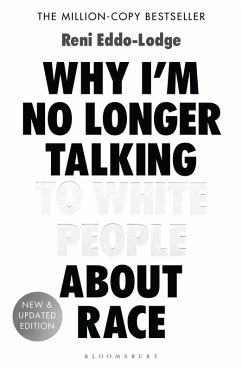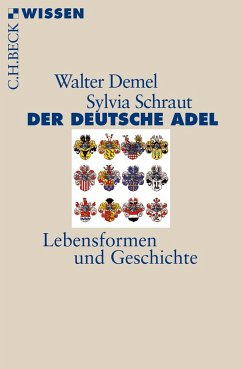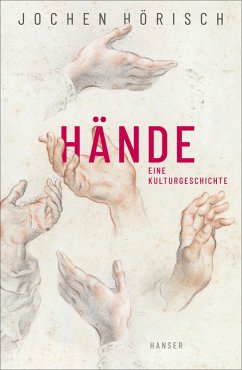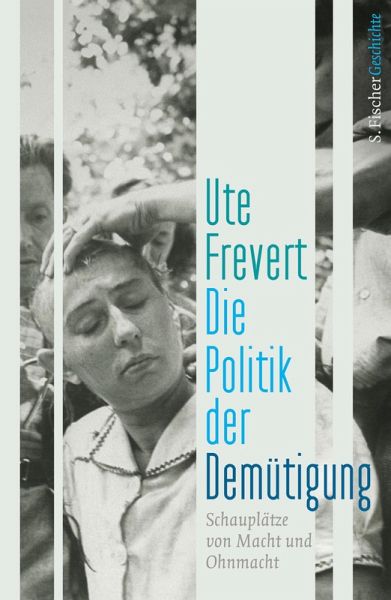
Die Politik der Demütigung (eBook, ePUB)
Schauplätze von Macht und Ohnmacht
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 25,00 €**
14,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
In einem brillanten Gang durch 250 Jahre Geschichte schildert die bekannte Historikerin Ute Frevert, welche Rolle die öffentliche Beschämung in der modernen Gesellschaft spielt. In den unterschiedlichsten Bereichen werden die Demütigung und das damit einhergehende Gefühl der Scham zum Mittel der Macht - ob in der Erziehung von Kindern, im Strafrecht oder in Diplomatie und Politik. So wurden nach 1944 in Frankreich Frauen, die sich mit deutschen Besatzern eingelassen hatten, die Haare geschoren. Richter in den USA bestrafen Bürger neuerdings damit, dass diese an belebten Straßen auf einem...
In einem brillanten Gang durch 250 Jahre Geschichte schildert die bekannte Historikerin Ute Frevert, welche Rolle die öffentliche Beschämung in der modernen Gesellschaft spielt. In den unterschiedlichsten Bereichen werden die Demütigung und das damit einhergehende Gefühl der Scham zum Mittel der Macht - ob in der Erziehung von Kindern, im Strafrecht oder in Diplomatie und Politik. So wurden nach 1944 in Frankreich Frauen, die sich mit deutschen Besatzern eingelassen hatten, die Haare geschoren. Richter in den USA bestrafen Bürger neuerdings damit, dass diese an belebten Straßen auf einem Schild ihr Vergehen kundtun müssen. Nicht zuletzt der Medienpranger - wie im Fall von Jan Böhmermanns Schmähgedicht auf den türkischen Präsidenten Erdogan - und das Internet haben die öffentliche Beschämung allgegenwärtig gemacht. Ute Frevert zeigt nicht nur an zahlreichen Beispielen aus der Geschichte, wie Demütigungen in Szene gesetzt wurden und werden (wobei sich die Bilder über Epochen und Kulturen hinweg erstaunlich gleichen). Sie macht auch klar, dass die Moderne den Pranger keineswegs abgeschafft, sondern im Gegenteil neu erfunden hat. Nicht mehr der Staat beschämt und demütigt, sondern die Gesellschaft.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.