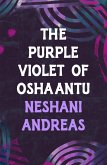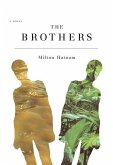Ein Requiem der besonderen Art!
Anne Berest geht dem Schicksal ihrer Familie nach. Auslöser ist eine Postkarte, die lediglich vier Namen enthält und damit an die vier Mitglieder der Familie erinnert, die interniert, deportiert und schließlich in Auschwitz ermordet wurden. Schon die Mutter der
Autorin hatte Nachforschungen zur Familiengeschichte angestellt, die sie im 1. Buch in einem großen…mehrEin Requiem der besonderen Art!
Anne Berest geht dem Schicksal ihrer Familie nach. Auslöser ist eine Postkarte, die lediglich vier Namen enthält und damit an die vier Mitglieder der Familie erinnert, die interniert, deportiert und schließlich in Auschwitz ermordet wurden. Schon die Mutter der Autorin hatte Nachforschungen zur Familiengeschichte angestellt, die sie im 1. Buch in einem großen Dialog der Tochter Anne erzählt.
Hier entfaltet sich nun die erschütternde Geschichte einer großbürgerlichen und gebildeten jüdischen Familie, die mit der Flucht der russischen Urgroßeltern nach der Oktoberrevolution beginnt. Sie fliehen nach Riga und schließlich nach Palästina, wo sie sich mehr recht als schlecht als Landwirte durchbringen, bis der Sohn sich zur Ausreise nach Frankreich entschließt, in das Land der Menschenrechte, das Land von Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit. Er ist als selbständiger Ingenieur mit Patenten und eigener Firma erfolgreich und seine Töchter besuchen renommierte Schulen, aber Frankreich verwehrt ihm mehrmals die Einbürgerung. Trotz aller Bemühungen bleibt er so der Unbehauste, und damit und mit dem Schicksal der Familie erinnert er das Bild des Juden Ahasver, der ruhelos umherirrt und keine Heimat findet.
Voller Vertrauen in seine neue Heimat will er den wachsenden Antisemitismus nicht wahrnehmen und meint, der zunehmenden Entrechtung der Juden dadurch zu entgehen, dass er den Hauptwohnsitz der Familie in sein Landhaus in der Normandie verlegt. Eine Flucht kommt für ihn nicht in Frage, und so zieht sich die Schlinge zu: die beiden jüngeren Kinder werden abgeholt, von den Verwandten aus Polen treffen keine Nachrichten mehr ein, schließlich werden sie selber interniert und deportiert. Einzig Myriam, die ältere Tochter, kann der Vernichtung entkommen.
Das 2. Buch spielt in der Gegenwart. An die Erzählung der Mutter schließt sich eine Art Krimi an, nämlich die Suche nach dem Absender der Postkarte, die alles ins Rollen gebracht hatte. Mutter und Tochter spüren in unterschiedlichsten Quellen dem Lebenslauf Myriams, der Großmutter nach. Auf Erzählungen der Großmutter können sie nicht zurückgreifen, weil die Großmutter schwieg, um die schrecklichen Erlebnisse nicht erneut zu beleben. Und weil sie, wie so viele andere Überlebende auch, ein schlechtes Gewissen gegenüber den Opfern hatte.
Wie ein großes Puzzle setzt sich so Stück für Stück das Schicksal der Familie zusammen.
Dabei muss sich der Leser mit zusätzlichen beklemmenden Tatsachen auseinandersetzen. So erfahren wir, sehr verhalten erzählt, wie Franzosen ihre Mitbürger durch Denunziation in die Folterkeller der Gestapo und wie sich die Nachbarn am Eigentum der Familie nach deren Deportation bereichert haben. Der Leser erfährt auch von dem blinden Fleck im französischen Auge, der die Kollaboration vieler Franzosen, z. B. auch der Polizei und Verwaltungsbehörden, mit den Deutschen lange Zeit verschwieg. Und dass erst 1996 die Todesursache „gestorben in der Deportation“ und die Verfolgung aus rassistischen Gründen anerkannt wurde.
Sehr beklemmend sind auch die Passagen, in denen die Autorin beschreibt, welche Auswirkungen die Tragödie ihrer Familie und ihr (laisiertes) Jüdisch-Sein auf iuhr eigenes Leben hat. Sie erzählt von ihren Ängsten und verleiht dem Phänomen deutliche Konturen, das man inzwischen als transgenerationale Traumaweitergabe bezeichnet.
Und zusätzliche Aktualität bekommt durch den nicht nur in Frankreich wieder zunehmenden Antisemitismus.
Wie Anne Berest diese Geschichte erzählt, ist ungemein packend. Das Erzählen der Familiengeschichte wird immer wieder von Fragen unterbrochen und damit immer in die Gegenwart hineingezogen; dazu trägt auch bei, dass die Mutter im Präsens erzählt. Damit gelingt es, die Personen nahe an den Leser heranzurücken, und diese Vermengung von Vergangenheit und Gegenwart macht den Roman so lebendig.
Das Hörbuch wurde eingelesen von Simone Kabst, die mit ihrer warmen und lebendigen Stimme den Erzählton des Romans perfekt trifft.