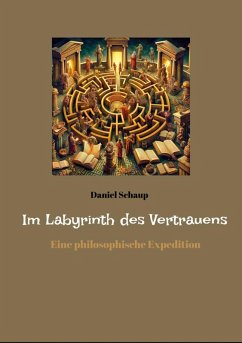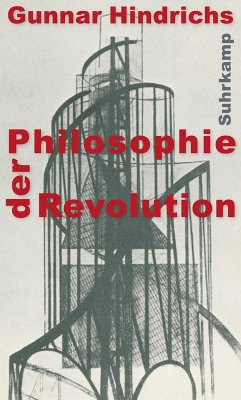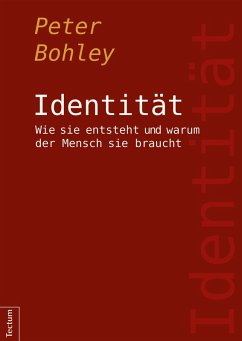Die Praxis des Vertrauens (eBook, ePUB)
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 24,00 €**
23,99 €
inkl. MwSt.
** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Vertrauen ist als Thema allgegenwärtig. Ob von Politikverdrossenheit, Bankenkrise oder Mißbrauchsskandalen die Rede ist - stets wird vorausgesetzt, daß Vertrauen eine zentrale Ressource sozialen Handelns ist, die nur schwer hergestellt, aber schnell zerstört werden kann. Aber was ist Vertrauen? Wie wird es geschaffen, wie zerstört? Wem sollten wir vertrauen, wem eher mit Mißtrauen begegnen? Martin Hartmann unternimmt in dieser profunden Studie den Versuch, Vertrauen sowohl begrifflich als auch historisch zu klären. Er veranschaulicht seine theoretischen Überlegungen immer wieder mit ko...
Vertrauen ist als Thema allgegenwärtig. Ob von Politikverdrossenheit, Bankenkrise oder Mißbrauchsskandalen die Rede ist - stets wird vorausgesetzt, daß Vertrauen eine zentrale Ressource sozialen Handelns ist, die nur schwer hergestellt, aber schnell zerstört werden kann. Aber was ist Vertrauen? Wie wird es geschaffen, wie zerstört? Wem sollten wir vertrauen, wem eher mit Mißtrauen begegnen? Martin Hartmann unternimmt in dieser profunden Studie den Versuch, Vertrauen sowohl begrifflich als auch historisch zu klären. Er veranschaulicht seine theoretischen Überlegungen immer wieder mit konkreten Beispielen aus Politik, Wirtschaft und Familie. Vertrauen, so zeigt er, reduziert nicht Komplexität, wie oft vermutet, es ist selbst ein hochkomplexes Phänomen, das deutlich macht, wie zerbrechlich und anspruchsvoll Prozesse der Vertrauensbildung sind.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.