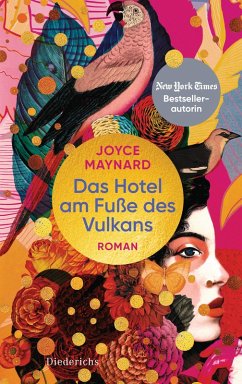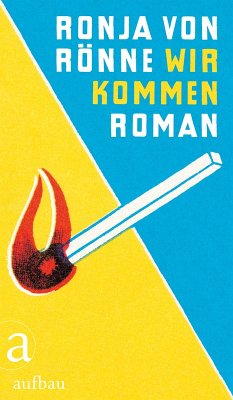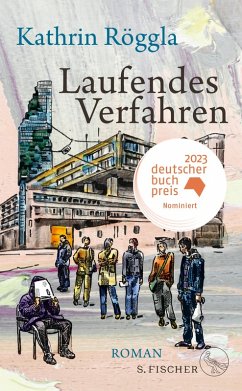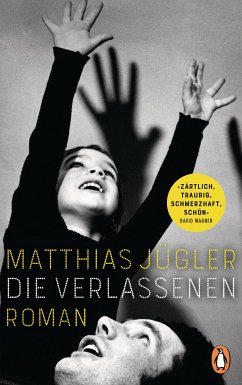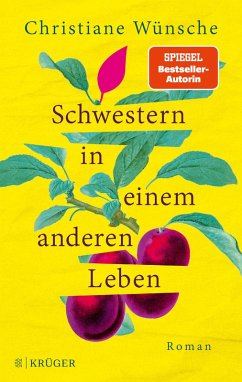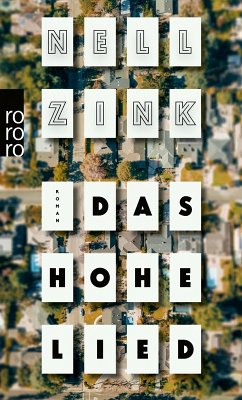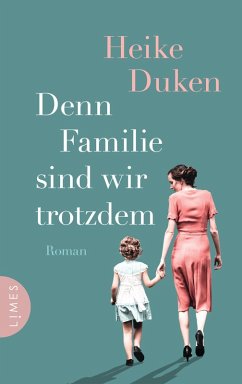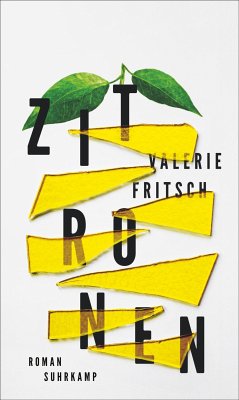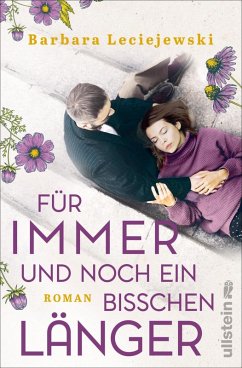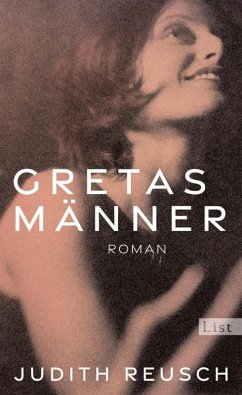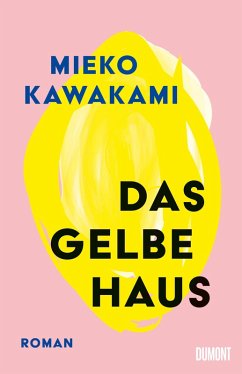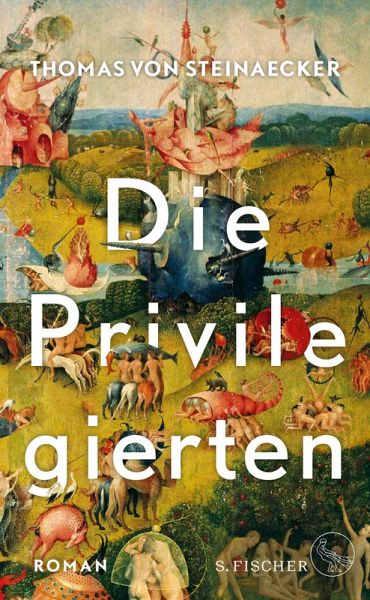
Die Privilegierten (eBook, ePUB)
Roman
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 26,00 €**
19,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Hätte nicht alles gut werden müssen? Der neue Roman von Thomas von Steinaecker über die verpassten Chancen einer Generation In Norwegen beginnt der Winter. Der erste seit vielen Jahren. In einer abgelegenen Hütte muss sich Bastian eingestehen, dass er zu alt ist, um dort zu überleben. Anstatt zur weit entfernten Siedlung aufzubrechen, beginnt er sich mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen. Mit seiner Kindheit in den 90ern zwischen Star Wars, Magnum-Eis und Lichterketten gegen Rechts. Der Herausforderung als junger Vater, Familie, Karriere und eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. U...
Hätte nicht alles gut werden müssen? Der neue Roman von Thomas von Steinaecker über die verpassten Chancen einer Generation In Norwegen beginnt der Winter. Der erste seit vielen Jahren. In einer abgelegenen Hütte muss sich Bastian eingestehen, dass er zu alt ist, um dort zu überleben. Anstatt zur weit entfernten Siedlung aufzubrechen, beginnt er sich mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen. Mit seiner Kindheit in den 90ern zwischen Star Wars, Magnum-Eis und Lichterketten gegen Rechts. Der Herausforderung als junger Vater, Familie, Karriere und eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Und mit den Jahren in der geschützten Wohnsiedlung in der Nähe Münchens, in denen die Welt immer bedrohlicher wurde. In seinem neuen Roman blickt Thomas von Steinaecker virtuos aus einer nahen Zukunft zurück auf unsere Gegenwart und zeigt, wie das Leben an uns vorbeirauscht, während wir um uns selbst kreisen. Hochaktuell erzählt »Die Privilegierten« von einer Generation, die alle Möglichkeiten hatte und dennoch scheitert.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.