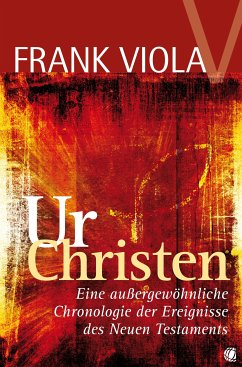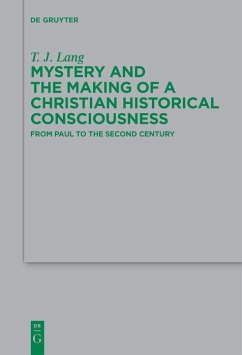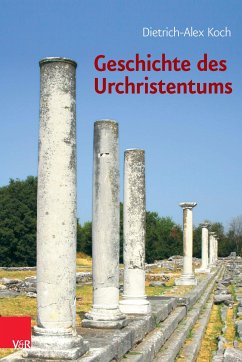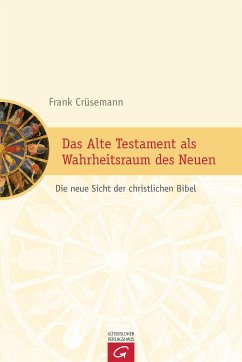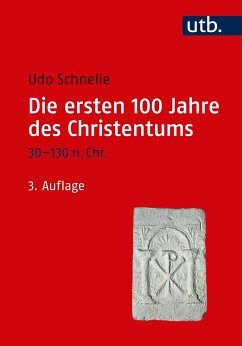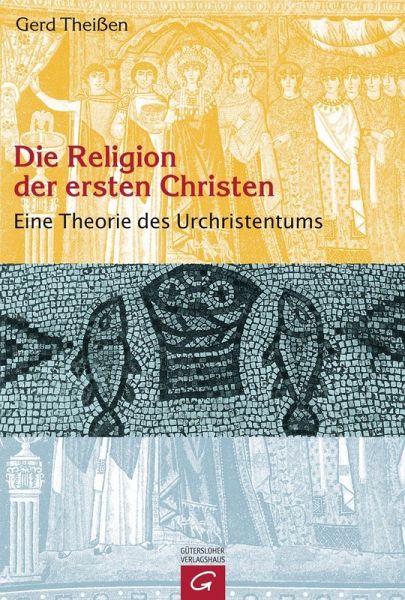
Die Religion der ersten Christen (eBook, ePUB)
Eine Theorie des Urchristentums
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 39,95 €**
32,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Eine Fortführung und Alternative zu einer »Theologie des Neuen Testaments« Die Dynamik des urchristlichen Glaubens ist in der Dynamik des Lebens verwurzelt. In diesem Buch zeigt Gerd Theißen, was die ersten Christen in ihrem Innersten bewegte. Sein Werk ist eine religionswissenschaftliche Beschreibung und Analyse des urchristlichen Glaubens. Es will weder rein deskriptiv die Theologie des Neuen Testaments beschreiben, noch konfessorisch ihren Glauben durch Wiederholung beschwören, sondern die Kraft dieses Glaubens verständlich machen. Theißen verfolgt dabei zwei Ziele: Einerseits unters...
Eine Fortführung und Alternative zu einer »Theologie des Neuen Testaments« Die Dynamik des urchristlichen Glaubens ist in der Dynamik des Lebens verwurzelt. In diesem Buch zeigt Gerd Theißen, was die ersten Christen in ihrem Innersten bewegte. Sein Werk ist eine religionswissenschaftliche Beschreibung und Analyse des urchristlichen Glaubens. Es will weder rein deskriptiv die Theologie des Neuen Testaments beschreiben, noch konfessorisch ihren Glauben durch Wiederholung beschwören, sondern die Kraft dieses Glaubens verständlich machen. Theißen verfolgt dabei zwei Ziele: Einerseits untersucht er das Leben der Urchristen und stellt ihre theologischen Aussagen in semiotische, psychische und historische Zusammenhänge. Auf diese Weise werden mit religionswissenschaftlichen Kategorien der Glaube, der Kult und das Ethos der frühen Kirche sichtbar. Andererseits zeigt er, wie sich das frühe Christentum vom Judentum fortentwickelte und eine autonome religiöse Zeichensprache schuf, die eine ungewöhnliche gemeinschaftsbildende Kraft hatte und die Geschichte umgestaltete.
Mit dieser neuartigen Annäherung überschreitet Gerd Theißen den nur innerkirchlichen Diskurs über die Theologie des Neuen Testamentes und macht urchristliches Leben und Denken auch denen zugänglich, die selbst der christlichen Weltdeutung fernstehen.
Mit dieser neuartigen Annäherung überschreitet Gerd Theißen den nur innerkirchlichen Diskurs über die Theologie des Neuen Testamentes und macht urchristliches Leben und Denken auch denen zugänglich, die selbst der christlichen Weltdeutung fernstehen.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.